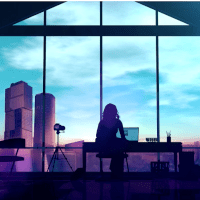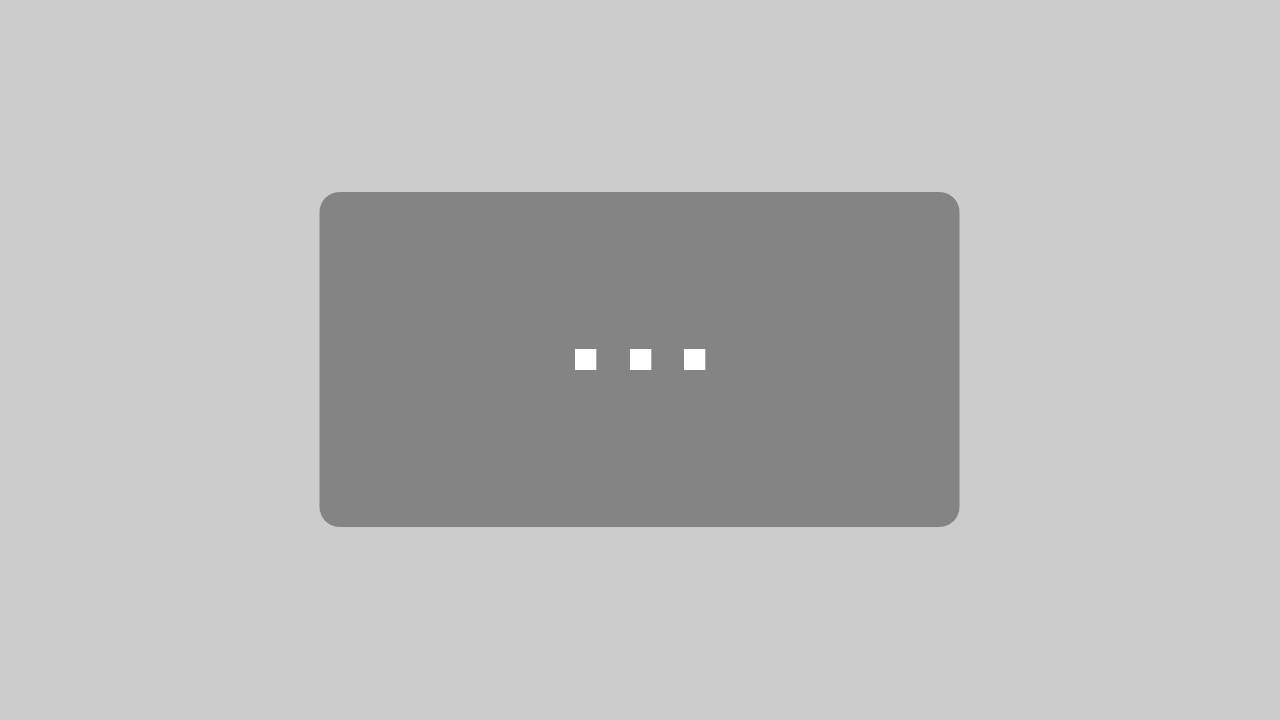Gesundheitsdaten smart nutzen
Unglaubliche Mengen an Daten über Krankheitsverläufe, Anamnesen und Therapieerfolge werden Tag für Tag an verschiedensten Stellen im Gesundheitswesen gesammelt. Doch bisher hakt es daran, diese Informationen zusammenzuführen, um sie analysieren und einen Nutzen daraus ziehen zu können. Wie könnten Lösungsansätze aussehen? Darüber sprachen Expertinnen und Experten beim BIG BANG HEALTH-Festival.
Unbegrenzte Möglichkeiten, ungenutzte Chancen
Nur wenige Themen betreffen wirklich jeden Menschen auf der Erde. Die Gesundheit ist eines davon. Wer bei guter Gesundheit ist, nimmt das meist als Selbstverständlichkeit wahr. Wer allerdings Probleme hat, hofft auf schnelle Hilfe. Doch die lässt manchmal auf sich warten. „Seltene Erkrankungen werden im Schnitt erst nach fünf bis sieben Jahren diagnostiziert“, sagt Anisa Idris, Vice President Market Access & Health Policy bei Ada Health. „In der Zeit erhält die Hälfte der Betroffenen eine Therapie für ein falsch diagnostiziertes Krankheitsbild.“ Das schadet den Patientinnen und Patienten und verursacht obendrein unnötige Kosten im Gesundheitswesen.
Es sind Fälle wie diese, in denen Ada Health ganz konkret helfen kann. Mit der App lassen sich – auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) – Symptome analysieren. Mehr als zwölf Millionen User hat Ada Health weltweit – darunter sind auch medizinische Fachkräfte, die damit bei der täglichen Arbeit unterstützt werden sollen. „In der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten ICD-11 sind aktuell knapp 55.000 Krankheiten verzeichnet. Angesichts dieser Menge wird Computerunterstützung benötigt, um den Überblick zu behalten. Aber ohne behandelnde Ärztinnen und Ärzte und deren Erfahrungsschatz geht es schlussendlich nicht. Keine KI kann heute das leisten, was der Mensch leisten kann“, so Idris beim BIG BANG HEALTH-Festival.
Personalmangel spitzt sich zu
Doch der Mangel an qualifiziertem Personal wird zunehmend zu einer nicht mehr zu bewältigenden Herausforderung und damit zu einer Gefahr für die Gesundheit von Millionen. Denn laut einer PwC-Studie könnten wegen des Fachkräftemangels im medizinischen Bereich etwa 1,8 Millionen Stellen bis 2035 nicht mehr besetzt werden. Das entspricht einem Engpass von 35 Prozent. Hinzu kommt: Nur etwa 30 Prozent der Ärztinnen und Ärzte können sich überhaupt vorstellen, bis zum Renteneintritt in ihrem Beruf tätig zu sein. Das sind – in Zeiten des demografischen Wandels, in denen der Versorgungsbedarf einer alternden Gesellschaft steigt – alarmierende Zahlen.
„Wir sprechen darüber, dass wir ein patientenzentriertes Gesundheitssystem brauchen. Aber zuallererst brauchen wir ein mitarbeiterzentriertes Gesundheitssystem“, sagt Martin Drees, Mitgründer und CEO von medflex. Das Unternehmen bietet einen Messenger, der die schnelle und sichere Kommunikation und den Dateien-Austausch zwischen Arzt und Patient sowie anderen an der Behandlung Beteiligten ermöglicht.
Doch so wie das hiesige Gesundheitssystem aktuell funktioniert, ist es nahezu unmöglich, die Arbeitsumgebung an die unterschiedlichen Lebensphasen der Mitarbeitenden anzupassen. So sind beispielsweise reduzierte Arbeitszeiten in einem Krankenhaus, in dem Schichtarbeit Usus ist, bis dato kaum denkbar. Das erschwert allerdings die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, und es erschwert Frauen nach der Elternzeit die Rückkehr in den Job. Außerdem bremsen solche Aussichten auch die Motivation, eine Karriere im medizinischen Bereich anzustreben.
Zeitliche und örtliche Flexibilität
Dabei gäbe es eine simple Lösung für viele Probleme der Branche, wie Drees betont: „Zeitliche und örtliche Freiheit sind aus meiner Sicht die größten ungenutzten Potenziale im Gesundheitswesen. Denn vieles muss immer noch in einer zeitlichen und örtlichen Synchronität stattfinden.“ Konkret heißt das: Medizinische Fachkräfte und Patientinnen und Patienten müssen sich in der Regel zur gleichen Zeit am gleichen Ort befinden. Drees empfiehlt, das zu hinterfragen. Müssen Patienten wirklich persönlich in die Praxis oder Klinik kommen, um etwas zu klären? Muss Kommunikation immer face-to-face in Echtzeit stattfinden, oder wäre auch asynchroner Austausch möglich?
„Asynchronität ist einer der größten Effizienztreiber, den wir aktuell nicht nutzen“, sagt Drees. „So ließe sich etwa aus dem Homeoffice heraus ein telemedizinisches Versorgungszentrum betreuen, über das beispielsweise Wund- und Verlaufskontrollen gemacht werden können. Das sind Dinge, für die niemand zwingend in eine Praxis kommen muss.“ Solche Angebote würde die Zahl der Patienten, die in weniger Zeit betreut werden können, erhöhen und Personal entlasten. Gleichzeitig werden Arbeitsplätze in der Branche attraktiver, da die Flexibilität, die mit telemedizinischen Anwendungen einhergeht, die Work-Life-Balance verbessert.
Vernetzung ist ausbaufähig
Doch woran hakt die Umsetzung solcher Ansätze? Zumindest nicht mehr an den rechtlichen Rahmenbedingungen. Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat in seiner Amtszeit diverse Gesetze auf den Weg gebracht, um die Digitalisierung zu beschleunigen – darunter das Digitale-Versorgung-Gesetz und das Krankenhauszukunftsgesetz.
Die Probleme liegen an anderen Stellen, wie eine Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung ISI im Frühjahr 2022 offenbarte: „Wir sehen unter anderem Handlungsbedarf beim Ausbau einer leistungsfähigen Breitbandinfrastruktur als Grundlage für die Digitalisierung, bei der Entwicklung einer E-Health-Strategie für Deutschland, einer besseren Vernetzung im Gesundheitssystem sowie einer deutlichen Verbesserung der IT-Sicherheit in Gesundheitseinrichtungen. Aber auch der Aufklärung der Bevölkerung und der Verbesserung der digitalen Kompetenzen der Gesundheitsberufe sollte eine absolute Priorität zukommen“, sagt Dr. Tanja Bratan, die am Fraunhofer ISI die Sektoranalyse koordiniert hat.
Immerhin: Die Deloitte-Studie „Shaping the Future of European Healthcare“ zeigt, dass 95 Prozent der Befragten, die in Krankenhäusern tätig sind, sowie 78 Prozent der Angestellten in Tageskliniken und Praxen großes Vertrauen in digitale Technologien haben und glauben, dass diese die Patientenversorgung verbessern können.
Daten, die da sind, auch konsequent nutzen
„Ich wäre schon froh, wenn man die Möglichkeiten der IT, die wir auch ohne KI hätten, besser nutzen würde“, sagt Professor Jürgen Schäfer, Leiter des Zentrums für unerkannte und seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum Marburg. Konkret meint er vor allem eine diagnoseunterstützende elektronische Patientenakte. Damit ließe sich ein besserer Überblick über komplexe Krankheitsverläufe gewinnen; die Patientenversorgung könnte reibungloser, unbürokratischer und personalisierter werden.

Mehr im Video! Die Telematik-Infrastruktur soll alle Akteure im Gesundheitswesen sicher miteinander vernetzen und durch den digitalen Austausch von Daten die Versorgung von Patientinnen und Patienten verbessern. Was in der Theorie gut klingt, läuft in der Praxis noch nicht ganz so rund. Doch woran liegt das und wie lässt sich die Telematik-Infrastruktur weiter ausbauen? Darüber diskutierten Dr. Jan Helmig (opta data Gruppe), Dr. med. Anke Diehl (Universitätsmedizin Essen) und Dr. med. Markus Leyck Dieken (gematik) beim BIG BANG HEALTH-Festival. Den gesamten Talk sehen Sie im Video
Doch ein weiteres Mittel zur Effizienzsteigerung, das bisher weitgehend ungenutzt bleibt, ist der Datenaustausch zwischen allen Leistungserbringern. „Medizin könnte manchmal ganz einfach sein, wenn man alle Informationen hätte und wenn man die Daten auch benutzen dürfte“, so Schäfer. „Krankenkassen beispielsweise verfügen über Unmengen Patientendaten, dürfen sie allerdings nicht nutzen.“
Standards sind in Arbeit
Eine einheitliche Infrastruktur zu schaffen, um alle Leistungserbringer zu vernetzen – das ist die Aufgabe der gematik. Denn das Potenzial, dass in der systematischen Erfassung, Verarbeitung und Nutzung medizinischer Daten steckt, ist enorm. Forschung könnte beschleunigt und neue Therapieansätze könnten schneller implementiert werden, wodurch die Menschen gesünder und länger leben könnten.
Basis dafür ist die Telematik-Infrastruktur (TI). Das ist quasi die Datenautobahn, die Patientendaten über die gesamte Patient-Journey hinweg verfügbar machen soll. Zumindest in der Theorie. Denn in der Praxis gilt: „Wir befinden uns aktuell noch in der Zeit der Telematik 1.0. Es gab bisher sicher keine La-Ola-Welle der Begeisterung“, sagt gematik-Chef Dr. med. Markus Leyck Dieken.
Ein Grund dafür: Bei allen Diskussionen über die Digitalisierung müsse man beachten, dass die Player im Gesundheitswesen keine homogene Gruppe seien, betont Jan Helmig, Leiter Digitalisierung bei der opta data Gruppe, einem Spezialisten für Abrechnungssysteme und TI. „Einerseits gibt es Leistungserbringer, die noch papierbasiert arbeiten und nicht mal Computersysteme haben. Die sind noch weit weg von der TI; man muss ihnen erst einmal den Nutzen von Software aufzeigen.“ Zur zweiten Gruppe gehören laut Helmig Personen, die digitalen Tools gegenüber zwar offen sind, sich aber mit der TI schwertun. „Diese Gruppe kann man vor allem dadurch überzeugen, dass man ihnen anhand praktischer Erfahrungen zeigt, welche Vorteile Vernetzung und Datenaustausch bringen.“
Keine Zweiklassenmedizin schaffen
Bei allen Bestrebungen, die Transformation voranzutreiben, darf eines allerdings nicht aus dem Blick verloren werden: Die Digitalisierung wird nicht in erster Linie für Ärztinnen und Ärzte und andere Leistungserbringer umgesetzt, sondern um die Versorgungssicherheit und -qualität für Patientinnen und Patienten zu verbessern. „Wir müssen immer den Menschen in den Mittelpunkt stellen und patientenzentrierte Lösungen anbieten“, so Helmig. „Denn wenn wir etwa über den Austausch von Daten sprechen, dann geht es um Patientendaten. Und da entscheidet der Patient, was mit den Daten passiert.“
Ganz wichtig ist Schäfer zu betonen, dass innovative Elemente für alle zugänglich sein müssen: „Es kann nicht sein, dass nur die Uniklinik moderne Medizin anbietet und der Landarzt abgekoppelt wird.“ Denn Gesundheit betrifft nun mal jede und jeden. Daher sollten auch alle von dem profitieren, was Digitalisierung schon heute möglich machen könnte – wenn denn alle Potenziale genutzt würden: schnellere, treffsichere Diagnostik sowie eine präzisere, personalisierte, nebenwirkungsärmere Therapie.

Daten sind die Zukunft der Medizin
Eigentlich könnte alles ganz einfach sein: Die Digitalisierung soll auch im Gesundheitswesen helfen, Prozesse effizienter zu gestalten. Das heißt in diesem Fall: Mitarbeitende entlasten und die Versorgung von Patientinnen und Patienten verbessern. Wären Gesundheitsdaten beispielsweise in der elektronischen Patientenakte für alle behandelnden Ärztinnen und Ärzte verfügbar, könnten etwa Doppelbehandlungen vermieden und der Behandlungsfortschritt beschleunigt werden. Doch die elektronische Patientenakte wird in Deutschland kaum genutzt. Ein Grund dafür liegt in undurchsichtigen Datenschutzbestimmungen.
Datenschutz darf nicht blockieren
„Statt eines Datenschutzbeauftragten bräuchten wir eigentlich einen Datennutzungsbeauftragten“, fordert daher die auf Medizinrecht spezialisierte Anwältin Professorin Alexandra Jorzig. „Wir haben 16 verschiedene Landesdatenschutzgesetze. Das ist ein Problem; wir kommen dadurch nicht vorwärts“, so Jorzig. „Natürlich brauchen wir einen gewissen Schutz sensibler Gesundheitsdaten. Aber es gibt auch das Selbstbestimmungsrecht des Patienten, und auf dessen Basis kann man Daten ebenfalls nutzen.“ Denn wem die Gesundheitsdaten gehören und wer über die Heraus- und Weitergabe bestimmen kann, sei juristisch ganz klar geregelt, sagt Jorzig: einzig die Patientin oder der Patient.
Zusammenarbeit muss verbessert werden

Mehr im Video! Schauen Sie sich jetzt den gesamten Panel-Talk zu Health Data Analytics vom BIG BANG HEALTH 2022 an
Um Patientinnen und Patienten zum eigenverantwortlichen Umgang mit ihren Gesundheitsdaten zu ermutigen – Stichwort Patienten-Empowerment –, ist es entscheidend, ihnen einen konkreten Nutzen für ihre Gesundheit aufzuzeigen. Welchen Vorteil haben sie davon, ihre Gesundheitsdaten digital zu erfassen und weiterzugeben? Und wie lassen sich Daten, die beispielsweise über eine Smartwatch ohnehin aufgezeichnet werden, nutzen, um die Gesundheit zu verbessern? Dafür werden Schnittstellen und Angebote benötigt, die nicht nur die Erfassung, sondern zugleich die Interpretation von Gesundheitsdaten effizient möglich machen.
Gefordert sind neben politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen auch die verschiedenen Akteure im Gesundheitswesen: Ärztinnen und Ärzte in Praxen und Kliniken, Heilmittelanbieter, Gesundheitsberufe, Apotheken, Krankenkassen. Doch häufig herrscht noch Zurückhaltung. Fragen Patientinnen und Patienten etwa nach der elektronischen Patientenakte, könne kaum ein Arzt darauf adäquat reagieren, kritisiert Andreas Fischer, Geschäftsführer von opta data.
„Ich glaube, dass die Zukunft der Medizin auf Daten basiert“, so Fischer. Neben der Eigenverantwortung der Patientinnen und Patienten ist für ihn die Standardisierung und Vernetzung entscheidend, damit alle Beteiligten die Gesundheitsdaten auch tatsächlich nutzen und daraus wertvolle Schlüsse ziehen können.
Schutz und Fortschritt zusammendenken
Auch Stefan Heinemann, Experte für Ethik und Ökonomie der digitalen Medizin und Gesundheitswirtschaft an der FOM Hochschule, plädiert für mehr Austausch zwischen den Akteuren im Gesundheitswesen. „Wenn jeder seinen eigenen Weg geht, kommen die großen Player aus dem Tech-Bereich und zeigen, wie es funktioniert. Dann können wir das, was unsere solidarische Gesundheitsversorgung intrinsisch stark macht, vielleicht überhaupt nicht mehr retten. Deswegen glaube ich, es gibt eine Pflicht, das, was legitim ist, auch wirklich zu tun und nicht nur darüber zu diskutieren“, sagt Heinemann.
Denn: Ethischen Grundsätzen widerspricht die Verwendung der Daten in seinen Augen nicht. Die Frage sei, ob es in Zukunft überhaupt irgendwelche Daten gebe, die keine Gesundheitsdaten seien. „Alles wird im Lichte von Vitalität, von Gesundheit interpretierbar“, ist Heinemann überzeugt. „Das wird auch ein Teil neuer Medizin.“
Wer also neue Impulse bei der Transformation des Gesundheitswesens setzen möchte, sollte loslegen und nicht zu lange darüber nachdenken, davon ist Jorzig überzeugt: „Man muss sich manchmal einfach auf den Weg machen und diesen im Zweifel im Prozess korrigieren. Das heißt nicht, dass wir alles freigeben, und jeder bekommt alle Daten und kann Missbrauch betreiben. Man kann den Datenschutz aufrechterhalten und trotzdem mal einen neuen Weg beschreiten. Das geht. Und wir sollten den Bürgern Eigenverantwortung im Umgang mit ihren persönlichen Daten zutrauen.“
„Lasst den Patienten selbst entscheiden!“
 Wo liegen die größten Herausforderungen, wenn es um die Nutzung digitaler Gesundheitsdaten geht?
Wo liegen die größten Herausforderungen, wenn es um die Nutzung digitaler Gesundheitsdaten geht? Was ist nötig, um die Nutzung und den Schutz medizinischer Daten in der Praxis zusammenzubringen?
Was ist nötig, um die Nutzung und den Schutz medizinischer Daten in der Praxis zusammenzubringen? Schauen wir ein paar Jahre voraus: Wie werden Daten in der Medizin Ihrer Meinung nach künftig genutzt?
Schauen wir ein paar Jahre voraus: Wie werden Daten in der Medizin Ihrer Meinung nach künftig genutzt?
Datenzugang als Gamechanger
Seit einigen Jahren zeigt sich im deutschen Gesundheitswesen ein verblüffender Widerspruch. Auf der einen Seite sind die Rahmenbedingungen für digitale Strukturen und Vernetzung vorhanden – das belegen die Zahlen. Immerhin betrug die Bruttowertschöpfung in der Gesundheitswirtschaft 2020 laut Statistiken der Bundesregierung mehr als 360 Milliarden Euro – also rund 12,1 Prozent des hiesigen Bruttoinlandprodukts. Und auch das Wachstum digitaler Gesundheitsanwendungen von 30 Prozent verspricht großes Potenzial.
Big Data, Cloud – aber wenig Vernetzung
Geld und Visionen sind also vorhanden. Doch auf der anderen Seite gibt es wohl keinen Sektor in Deutschland, der derart hinter seinen Möglichkeiten bleibt und so dringend ein digitales Update, insbesondere auch der Infrastruktur, benötigt. Doch was verhindert im Zeitalter von Big Data, Cloud-Computing und Künstlicher Intelligenz den digitalen Fortschritt im deutschen Gesundheitswesen?
„An den Rahmenbedingungen liegt es jedenfalls nicht, denn in keinem Bereich wird so viel Geld investiert wie im Gesundheitswesen“, sagt Dr. Gottfried Ludewig, Senior Vice President Health Industry der Telekom-Tochter T-Systems International, auf dem BIG BANG HEALTH-Festival.
Trotzdem lahmt die digitale Entwicklung. Während andere Branchen spätestens mit Beginn der Coronapandemie einen Digitalisierungsschub erlebten, ist davon im Gesundheitssektor aufgrund starrer Strukturen, fehlender Vernetzung, datenschutzrechtlicher Barrieren und bürokratischer Hürden wenig zu spüren.
Im Kleinen vermittelt dieses Dilemma das Apple-Paradoxon: Ein Alltagsgegenstand wie die Apple Watch scannt und digitalisiert Gesundheitsdaten zur Herzfrequenz, Ausdauer oder zu Bewegungszyklen von Millionen Menschen und übermittelt sie via Cloud in die Daten-Schatzkammer der US-Firma Apple. Den Weg in die Krankenakte der Trägerin oder des Trägers der Uhr finden diese wertvollen medizinischen Daten allerdings nicht. Im Großen zeigt sich der Fortschrittsstau im jahrelangen Kampf darum, E-Rezepte oder die digitale Patientenakte als Standard zu etablieren – beides eine schwere Geburt.
Ludewig kennt als langjähriger Leiter der Abteilung Digitalisierung und Innovation im Bundesgesundheitsministerium die Hemmnisse am Markt nur zu gut. Auch für ihn sind die datenschutzbasierte Regulatorik und die mangelnde interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Marktteilnehmern der Grund für die Digitalisierungslücke.
Digitales Kreislaufsystem nötig
„Wenn sich die per Gesetz vorgegebene strenge Regulatorik nicht ändert und wir essenzielle Gesundheitsdaten nicht standardisiert nutzen können, wird es keine digitale Zukunftsmedizin geben“, ist sich Ludewig sicher. Bei der Vernetzung müssten neben dem Staat auch Unternehmen, Kliniken, Krankenkassen und alle weiteren Player am Gesundheitsmarkt umdenken und größere Budgets für IT-Projekte bewilligen.
T-Systems arbeite zum Beispiel als größter IT-Dienstleister im Gesundheitswesen aktiv an einem Wandel im Markt mit: „Wir bieten etwa eine digitale Infrastruktur für die gesetzliche Krankenversicherung an, verwalten die Daten von über 100 Kliniken in der Cloud oder haben das neue Krankenhausinformationssystem iMedOne in über 240 Kliniken implementiert“, zählt Ludewig auf. Doch auch diese Entwicklung hat Grenzen: Es gibt in Deutschland eine sektorale Trennung zwischen Gesundheitsservices, Anbietern und Empfängern.

Mehr im Video! Schauen Sie sich jetzt die gesamte Keynote von Dr. Gottfried Ludewig, Gesundheitsexperte der Telekom-Tochter T-Systems International, beim BIG BANG HEALTH 2022 an
Die vielen Player am diversifizierten Gesundheitsmarkt und die durch das föderale System bedingten Unterschiede machen es schwer, dass alle an einem Strang ziehen. Es gebe, so Ludewig, in Deutschland zu viele Eigeninteressen und zu wenig gemeinschaftliche innovative Ideen, die sich systematisch auf die gesamte Branche übertragen ließen: „Wir müssen Allianzen bilden und zusammenarbeiten, ansonsten werden wir keine Veränderung erreichen.“
In der Vision des Experten müsste die moderne Medizin und Gesundheitsversorgung in Deutschland als eine Art digitales Kreislaufsystem funktionieren, innerhalb dessen Sphäre Wissen und Services zwischen allen Teilnehmenden zirkulieren – zum Wohle und Nutzen der Patientinnen und Patienten.
Keine Daten-Blackboxes bilden
Erste Ansätze smarter digitaler Behandlungsmethoden ergeben sich in der Telemedizin – etwa durch telemedizinische Monitoring-Systeme, welche die Sterberate bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen laut einer Studie der Charité Berlin von elf auf acht Prozent senken. Auch durch KI-gestützte Anwendungen oder Interaktionsformen über Virtual Reality sollen künftig aus medizinischer Sicht Früchte tragen. Um diese Transformation voranzutreiben, so Ludewig, werde es Zeit, den Kurs von Telekom-CEO Timotheus Höttges endlich auch im Gesundheitswesen umzusetzen. Dieser hatte vor einigen Jahren für alle Geschäftsbereiche der Telekom vorgegeben: „Und alles, was vernetzt werden kann, wird auch vernetzt. Das betrifft Menschen, Maschinen und Produkte gleichermaßen.“
Die Symbiose aus Gesundheit und Technologie soll nicht dazu dienen, Daten-Blackboxes zu bilden. Eher geht es darum, medizinische Daten zu bündeln und gemeinsam effektiv um des Fortschritts willen auszuwerten. Wer aber davon träume, diesen Weg allein zu gehen, der scheitere, so Ludewig: „Nur durch Allianzen und Synergien können wir eine smarte, digitale, personalisierte Medizin entstehen lassen.“

Das Ende des Hypes?
Künstliche Intelligenz (KI) wurde zeitweise bei jeder Gelegenheit als Allheilmittel für strukturelle Probleme im Gesundheitswesen sowie als Werkzeug, um Krankheiten zu eliminieren, präsentiert. Dann kam Corona.
„Hat uns KI vor der Pandemie gerettet? Hat sie uns gerade zu Beginn geholfen? Nicht wirklich“, sagt Alexander Britz, KI-Experte von Microsoft Deutschland, beim BIG BANG HEALTH-Festival. Es gab schlicht keine Daten für KI. Die Stimmung hat sich stattdessen abgekühlt; Artikel über neue Studien werden nicht mehr mit euphorischen Überschriften versehen. „Es wird vorsichtiger formuliert, statt ein Versprechen zu geben. So heißt es etwa nicht mehr, dass Lungenkrebs dank KI Geschichte ist, sondern KI könnte helfen.“
 Hätte KI uns zu Beginn der Pandemie theoretisch nutzen können?
Hätte KI uns zu Beginn der Pandemie theoretisch nutzen können? Was ist Ihr persönliches Verständnis von KI?
Was ist Ihr persönliches Verständnis von KI? Und wie kann das in der Praxis im Gesundheitswesen aussehen?
Und wie kann das in der Praxis im Gesundheitswesen aussehen?Videocredit: Getty Images/andrearuffa
Bildcredits: Big Bang Health/Caroline Schlüter, Big Bang Health/Michael Schwettmann, Getty Images/ipopba