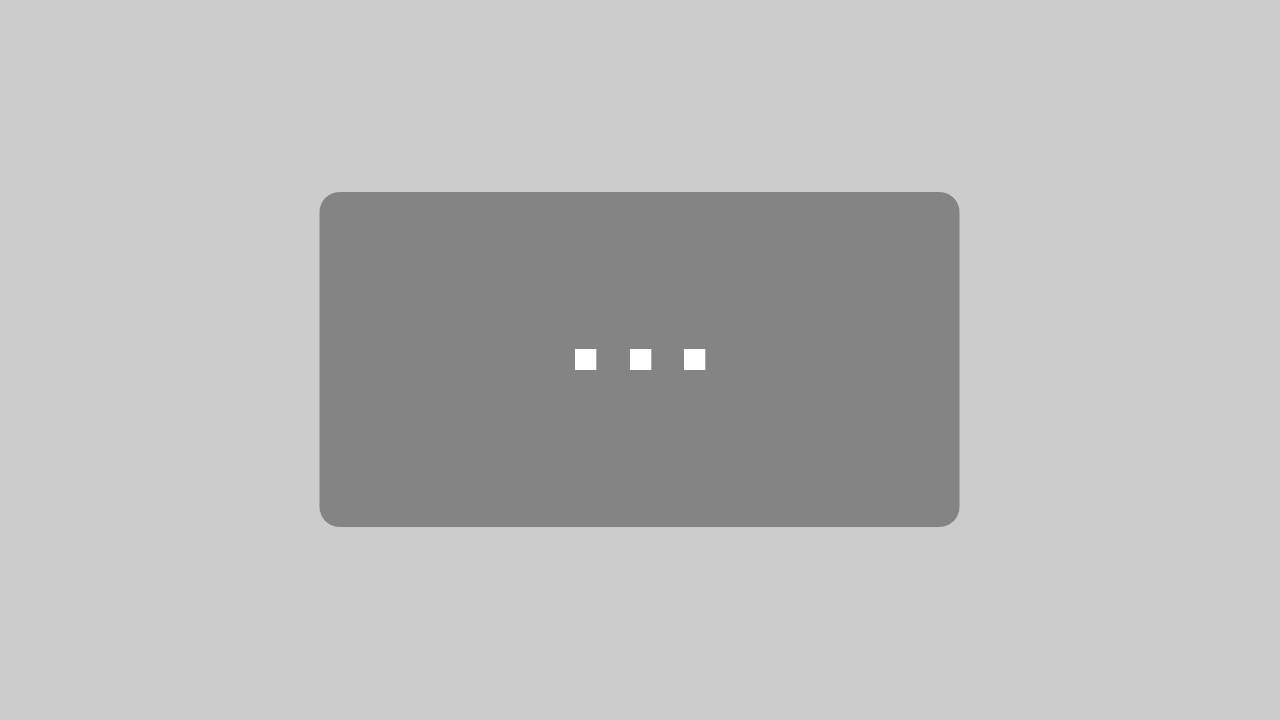Alle auf einen Stand bringen
Die Vernetzung aller Leistungserbringer im Gesundheitswesen ist Grundvoraussetzung für die Digitalisierung des Sektors. Wie sie gelingen kann und voran es hakt – darüber diskutierten Expertinnen und Experten beim BIG BANG HEALTH 2022.
Vier Erfolgsfaktoren für die Transformation
Bevor über die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen gesprochen werden kann, muss man sich zunächst einmal ein klares Bild darüber verschaffen, was Digitalisierung in der Branche überhaupt genau bedeutet.

Mark Steinbach: Der Diplom-Kaufmann ist seit 2005 Geschäftsführer der opta data Gruppe. Er führt die Unternehmensgruppe gemeinsam mit Andreas Fischer. In seiner Keynote beim BIG BANG HEALTH-Festival 2022 sprach Steinbach darüber, welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, damit die Transformation des Gesundheitssektors gelingen kann
Den gesamten Versorgungspfad im Fokus
Im Kern geht es darum, Kollaboration zwischen den unterschiedlichen Beteiligten zu ermöglichen. Diese lassen sich klaren Sektoren oder Stakeholder-Gruppen zuordnen. Das sind die Patientinnen und Patienten, die Ärztinnen und Ärzte in den Praxen und Kliniken, die Apotheken, die diversen Gesundheitsberufe – etwa Heilmittel- und Hilfsmittelanbieter, Pflegedienste, Krankentransport und Rettungsdienst – sowie die Kostenträger.
Es geht also im Grunde um den vollständigen Versorgungspfad im Sinne einer Wertschöpfungskette im Gesundheitswesen. Gerade der ärztliche Sektor – ob ambulant oder stationär – steht seit vielen Jahren im Fokus, weil dort der Rahmen für die gesamte Versorgung abgesteckt wird. Aber auch die nachfolgenden Stakeholder in dieser Wertschöpfungskette sind für die Erbringung der Leistungen für die Patientinnen und Patienten wichtig. Und bei denen kommt der Nutzen der Digitalisierung erst dann an, wenn alle beteiligten Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer an die digitalen Austauschprozesse angebunden sind.
Große Unterschiede beim Stand der Digitalisierung
Wenn diese Stakeholder-Gruppen nun alle effizient miteinander arbeiten sollen, tut sich schnell ein Problem auf: Der digitale Status quo könnte unterschiedlicher nicht sein.
So finden wir bei der Gruppe der Patientinnen und Patienten noch sehr unterschiedliche Voraussetzungen im Hinblick auf die Nutzung digitaler Angebote vor. Wir beobachten deutliche Unterschiede zwischen den Altersgruppen.
Bei Ärztinnen und Ärzten sind sowohl in den Praxen als auch in Kliniken häufig große IT-Landschaften im Einsatz, die allerdings eine geringe Kompatibilität aufweisen und untereinander häufig nicht kommunizieren können. Ähnlich sieht es in den Apotheken aus.
Bei den Leistungserbringern der Gesundheitsberufe zeigt sich ein stark heterogenes Bild. Sanitätshäuser oder Medizintechnikbetriebe beispielsweise sind häufig sehr große Organisationen, die klare Prozesse definiert haben und in denen digitale Workflows effizient etabliert sind. In anderen Bereichen, beispielsweise bei Therapeuten, ist der Einsatz digitaler Lösungen häufig nicht so verbreitet.
Krankenkassen wiederum haben zwar große IT-Landschaften, aber die Gesetzgebung gibt häufig noch ein papierbasiertes Arbeiten vor, wodurch digitale Prozesse nicht möglich sind.
Telematik-Infrastruktur garantiert technologischen Mindeststandard
Aufgrund dessen ist eine digitale Kommunikation aller Stakeholder im Gesundheitswesen aktuell noch sehr schwerfällig. Insofern brauchen wir dringend eine stärkere Vernetzung, den Brückenbau zwischen den Stakeholdern. Das soll die Telematik-Infrastruktur (TI) leisten. Denn damit überhaupt eine übergreifende Zusammenarbeit einer kritischen Masse unter den Akteuren der verschiedenen Sektoren möglich ist, benötigen diese einen technologischen Mindeststandard und funktionierende Schnittstellen zwischen den Informationssystemen.
Ein erster Erfolgsfaktor für die Digitalisierung ist daher die Identifikation besonderer Anforderungen der einzelnen Akteure beziehungsweise Berufsgruppen an die digitale Kommunikation. Dann wird auch der Wille aufkommen, die Digitalisierung lokal und individuell schnell voranzutreiben.
Zweiter Erfolgsfaktor sind Gesetzesinitiativen wie das Digitale-Versorgung-Gesetz oder das Patientendaten-Schutz-Gesetz. Wir benötigen in Deutschland eine konsequente Ausrichtung auf den Patientennutzen. Wenn es gelingt, dass wir den Endkunden – also die Patientin und den Patienten – in den Fokus nehmen, dann werden alle Stakeholder im Gesundheitswesen das gleiche Ziel verfolgen. Und dann wird es auch gelingen, dass sich der Nutzen für Patientinnen und Patienten in jeder Dienstleistung, in jedem Produkt in der Wertschöpfungskette widerspiegelt.

Mehr im Video! Schauen Sie sich jetzt die gesamte Keynote von Mark Steinbach, Geschäftsführer der opta data Gruppe, beim BIG BANG HEALTH 2022 an
Austausch der Stakeholder ist das A und O
Die Stakeholder müssen miteinander in den Austausch kommen. Das ist der Kernpunkt. Daher der dritte Erfolgsfaktor: Wir müssen die Systeme miteinander vernetzen. Das geschieht über Interoperabilität – über eine sichere Datenautobahn, die jeder Stakeholder im deutschen Gesundheitswesen nutzen kann – und über die Einführung sektorübergreifender Nomenklaturen. Denn Sektorengrenzen können besonders einfach überwunden werden, wenn eine gemeinsame Sprache genutzt wird. Der Aufbau und der Anschluss an die TI erfolgen nun sukzessive. Sie bietet aber noch viele Potenziale, denn heute finden noch viel zu wenige nutzbringende Anwendungen, gerade aus Sicht der Stakeholder, in der TI statt.
Der vierte Erfolgsfaktor: Wir dürfen nicht statisch bleiben, sondern müssen bereit für Veränderungen sein. Patientinnen und Patienten durchlaufen verschiedene Lebensphasen, in denen sie unterschiedliche Bedürfnisse haben. Das bietet viele Ansatzpunkte für digitale Lösungen.
Alle vier Erfolgsfaktoren zusammen ergeben das Zielbild für eine erfolgreiche Digitalisierung im Gesundheitswesen. Unser Ziel lautet: Der Patient steht im Mittelpunkt, und alle Akteure sind um ihn herum im Austausch, haben den gleichen Wissensstand, betreuen den Patienten von der Geburt bis ins hohe Alter und werden so zum Lebensbegleiter. Der Weg zu dieser umfassenden Vernetzung ist allerdings noch weit.
So gestaltet die gematik die Zukunft mit
Nicht jeder macht seins, sondern alle machen eins: Der Titel der Keynote von Dr. med. Markus Leyck Dieken beim BIG BANG HEALTH zeigte bereits, was aktuell bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen eines der größten Probleme ist. Denn solange nicht alle Beteiligten an einem Strang ziehen, kann es kaum vorangehen.
Einigkeit herzustellen und einen gemeinsamen technischen Weg vorgeben – das ist die Aufgabe von Leyck Dieken. Der gematik-Geschäftsführer ist so etwas wie der Chef-Digitalisierer des hiesigen Gesundheitswesens. Und das hinkt etwa im Vergleich zu Skandinavien, den Niederlanden, Estland, Spanien oder Israel digital hinterher. Etwas, was wir dringend bräuchten, sei deshalb die elektronische Identität (e-ID), so Leyck Dieken.
 Warum ist Ihnen die elektronische Identität ein so großes Anliegen?
Warum ist Ihnen die elektronische Identität ein so großes Anliegen? Wie kann die Digitalisierung der Medizin vorangetrieben werden?
Wie kann die Digitalisierung der Medizin vorangetrieben werden? Eine Basis für die Transformation ist der Verzeichnisdienst der gematik. Was hat es damit auf sich?
Eine Basis für die Transformation ist der Verzeichnisdienst der gematik. Was hat es damit auf sich?
Der Schlüssel zur Transformation?
Think big: Zugegeben, dazu neigt die Mehrheit, wenn es um die Digitalisierung geht. Und das schreckt ab. Zu groß und kaum händelbar wirken Projekte, wenn auf einen Schlag der ganz große Wurf gelingen soll. Besser ist es, mit der Transformation im Kleinen zu beginnen – im Falle des Gesundheitswesens etwa zunächst auf regionaler Ebene eine Vernetzung anzustreben. Wie das gelingen kann und welche Herausforderungen noch zu meistern sind, darüber sprachen
- Birgit Fischer, Staatsministerin a.D.,
- Martin Wolf,Vorstand und Sprecher des evangelischen Krankenhauses St. Johannisstift Paderborn sowie Sprecher der Gesundheitsplattform OWL und
- Toralf Schnell, Chief Digital Officer und Leiter der Stabsstelle Digitalisierung an der Universitätsmedizin Greifswald.
Frau Fischer, wie wichtig ist Regionalisierung für ein digitalisiertes Gesundheitswesen?

Mehr im Video! Birgit Fischer (Staatsministerin a.D.), Martin Wolf (St. Johannisstift Paderborn) und Toralf Schnell (Universität Greifswald) sprachen beim BIG BANG HEALTH 2022 darüber, wie Vernetzung im Gesundheitswesen auf regionaler Ebene gelingen kann. Den gesamten Talk sehen Sie im Video
Birgit Fischer: Regionalisierung ist einer der Schlüssel, um Digitalisierung großflächig im Gesundheitswesen umzusetzen. Bisher scheitern Fortschritte oft daran, dass alle Beteiligten in ihren jeweiligen Systemen denken und handeln – inklusive eigenen Rechtsrahmens und Finanzierungsmodells. Dadurch ist es in unserem Versorgungssystem sehr schwierig, Schnittstellen zwischen einzelnen Bereichen zu überwinden und Kooperationen zwischen den Marktteilnehmenden anzustoßen – obwohl es für ein ausgereiftes digitales Gesundheitssystem genau diese Initiativen bräuchte. Auf regionaler Ebene haben wir dafür eigentlich die besten Voraussetzungen: Erstens sind die entscheidenden Player vor Ort präsent; zweitens ist die Notwendigkeit der Vernetzung sowie die konkrete Bereitschaft zur Zusammenarbeit größer, damit auch künftig alle Bereiche der Gesundheitsversorgung abgedeckt sind.
Herr Schnell, Sie treiben als Chief Digital Officer die Digitalisierung an der Universitätsmedizin Greifswald voran. Haben Sie Beispiele für ein gelungenes Zusammenspiel von Digitalisierung und Regionalisierung?
Toralf Schnell: Mit unseren circa 4.300 Mitarbeitenden, rund 2.000 Studierenden sowie etwa 430 Auszubildenden für Pflegeberufe nehmen wir eine tragende Rolle in der regionalen Versorgung der Region Vorpommern ein – und dafür setzen wir ganz gezielt digitale Projekte um. Im Rahmen des Pilotprojekts „MV|Life“ setzen wir seit 2019 punktuell Drohnen ein, um in Notsituationen zum Beispiel Defibrillatoren in ländliche Regionen zu liefern oder auch Blut und Gewebeproben ohne großen Aufwand zu transportieren. Ein weiteres Projekt ist unser „Telenotarzt“: Eine Notärztin oder ein Notarzt fährt nicht mehr im Rettungswagen mit, sondern sitzt in einem Lagezentrum in der Universitätsmedizin vor unzähligen Monitoren und unterstützt die Einsatzkräfte vor Ort beratend auf digitalem Weg. Im akuten Notfall rückt sie oder er selbstverständlich selbst aus und wird von einem unserer Helikopter zügig an den Unglücksort gebracht.
Herr Wolf, als diakonischer Gesundheitsträger müssen Sie in Paderborn Tradition und Innovation miteinander vereinen. Wie gelingt Ihnen das?
Martin Wolf: Von Grundgedanken her ist es erst einmal egal, ob wir Diakonie, Caritas oder Universitätsmedizin sind. Wir haben alle den Auftrag, hohe medizinische Qualität anzubieten, die Patientinnen und Patienten gut zu versorgen und mit den vorhandenen Ressourcen vorausschauend umzugehen. Darauf ist Digitalisierung die beste Antwort. Im St. Johannisstift arbeiten wir sehr eng mit der Stadt Paderborn zusammen. Bereits während des Wirkens von Heinz Nixdorf…
…einem deutschen Computerpionier, der sich früh mit der Vernetzung digitaler Systeme beschäftigt und weltweit erfolgreiche Kleinrechner entwickelt hat…
Wolf: … sind erste Ideen zur Vernetzung von Krankenhäusern und niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten entstanden. Das wurde bis heute kontinuierlich weiterentwickelt. Auf dieser Basis haben wir die digitale Gesundheitsplattform OWL gestartet, die alle fünf Akutkrankenhäuser der Region sowie mehr als 150 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, die im Praxisnetzwerk organisiert sind, miteinander vernetzt. Damit möchten wir die „digitale Kleinstaaterei“ innerhalb des Gesundheitswesens auflösen und die Interaktion aller Beteiligten verbessern.
Was muss generell passieren, damit die Vernetzung innerhalb des Gesundheitssystems schneller vonstattengeht?
Fischer: Mir begegnen heute immer wieder Themen, die auch vor 30 Jahren schon diskutiert wurden – dazu zählt die Vernetzung. Verändert hat sich allerdings, dass uns inzwischen digitale Lösungen und somit eine Grundvoraussetzung für Vernetzung zur Verfügung stehen. Die Telemedizin ist ein gutes Beispiel dafür. Doch leider denken wir immer noch zu systemimmanent, statt über die Sektorengrenzen hinauszuschauen. So könnte zum Beispiel in regionalen Experimentierräumen erprobt werden, wie sektorenübergreifende Kooperationen die Versorgung verbessern. Wenn wir diesen Schritt wagen, landen wir automatisch bei weiterführenden Fragestellungen, die in Verbindung mit einer digitalen Gesundheitsversorgung auftauchen – zum Beispiel dem Umgang mit Datenschutz. Ich empfehle in dieser Hinsicht dringend, auch auf praktische Lösungen anderer Länder zu schauen.
Herr Wolf, inwiefern sind die Entwicklungen in anderen Ländern für Sie eine Inspiration?
Wolf: Auch wir nehmen das digitale Gesundheitswesen in Estland oder Österreich natürlich wahr und versuchen, daraus zu lernen. Wenngleich die Strukturen oftmals andere sind als bei uns – sie sind weder föderal organisiert, noch haben sie klar abgetrennte Sektoren innerhalb des Gesundheitssystems. Wir müssen in dieser Hinsicht flexibler und offener werden, gerade bei Kooperationen. Die Erfahrung, dass viele Beteiligte ihre Ideen immer zu 100 Prozent umsetzen wollen, führt meist in eine Sackgasse. Warum reichen nicht auch mal 80 Prozent, sodass wir zu einem Kompromiss kommen, mit dem wir unser Gesundheitswesen konstruktiv gemeinsam tatsächlich nach vorn bringen? Nur dann können Digitalisierung und Vernetzung für ein ganzheitliches System funktionieren.
Schnell: Ich stimme sowohl Frau Fischer als auch Herrn Wolf zu. Wir haben in den vergangenen Jahren während der Coronapandemie gesehen, wie schnell Veränderungen möglich sind, wenn man denn will beziehungsweise muss. Ich wünsche mir zudem mehr Mut, Gesetze und Regularien anzupassen. Hier stehen wir uns oft selbst im Weg. Und wir benötigen für alle Ebenen ausreichend finanzielle Mittel. Nur mit begrenzten Förderprogrammen für einzelne Träger sind Innovationen nicht umzusetzen. Wie Frau Fischer sagte, lohnt sich zudem der Blick über die Grenzen des eigenen Systems hinaus: So haben wir mit der Universitätsmedizin Seeland aus Dänemark ein Projekt für die Krebsversorgung im ländlichen Raum initiiert. Gefährdete und Erkrankte werden angeleitet, sich zu Hause Blut abzunehmen und es anschließend in einem speziellen Gerät auswerten zu lassen. Die Informationen werden dann digital an medizinische Fachkräfte im lokalen Klinikum zur Auswertung übermittelt. Gerade in ländlichen Regionen kann dieser medizinische Remote Service sehr effizient sein und die Behandlung unterstützen.
Wo bleiben aktuell in Deutschland noch besonders viele Potenziale ungenutzt? Wo könnte die Zusammenarbeit auf regionaler Ebene insgesamt effizienter sein?
Fischer: Gerade in Ballungszentren, wo viele Menschen leben und es eine hohe Dichte an Versorgern und gesundheitsbezogenen Kompetenzen gibt, müssen wir Experimentierräume entschiedener nutzen, um neue Konzepte zu testen. Doch dafür brauchen wir die politischen und finanziellen Freiheiten sowie auch die Bereitschaft, Projekte gemeinsam entwickeln zu wollen. Die große Herausforderung wird es sein, die verschiedenen Interessen auszutarieren.
Wolf: Erstens: Es muss uns gelingen, dass sich die Akteure innerhalb der Gesundheitsbranche gegenseitig vertrauen. Das erfordert auch den Willen, in schwierigen Situationen voranzuschreiten sowie eigene Bedürfnisse manchmal zurückzustellen. Zweitens müssen wir den Patientinnen und Patienten unsere Vorhaben vernünftig und transparent vermitteln. Ein Beispiel: Anfangs haben wir bei der Gesundheitsplattform OWL lange und viel über die richtige Technik nachgedacht. Doch mit einem guten Partner erübrigt sich das schnell. Nicht weniger komplex ist da der Wissenstransfer auf die Nutzenden: Patientinnen und Patienten müssen alles verstehen, einen Nutzen in einem Angebot sehen und Raum haben, Fragen dazu zu stellen.

„Alle müssen auf das gleiche Tor spielen“
Eine bestmögliche Patient-Journey gewährleisten: Um dieses Ziel zu erreichen, gründete der Apotheker Dr. Sven Simons zusammen mit Dr. Peter Schreiner und Maximilian Achenbach die Plattform gesund.de. Damit wollen sie lokale Gesundheitsversorger wie Apotheken und Sanitätshäuser sowie Ärztinnen und Ärzte optimal mit Patientinnen und Patienten vernetzen. Zudem greift die Plattform aber auch den stationären Versorgern unter die Arme – insbesondere den lokalen Apothekerinnen und Apothekern. Getreu dem Motto „Lokal.Digital“ wird so das Beste aus zwei Welten miteinander vereint.
 Wie profitieren Nutzerinnen und Nutzer von gesund.de?
Wie profitieren Nutzerinnen und Nutzer von gesund.de? Im Internet gibt es bereits zahlreiche Online-Apotheken. Wieso legen Sie bei ihrem Service den Fokus auf die lokalen Anbieter? Oder anders gefragt: „Lokal.Digital“ – widerspricht sich das nicht?
Im Internet gibt es bereits zahlreiche Online-Apotheken. Wieso legen Sie bei ihrem Service den Fokus auf die lokalen Anbieter? Oder anders gefragt: „Lokal.Digital“ – widerspricht sich das nicht? Seit dem 1. September müssen Apotheken in der Region Westfalen-Lippe E-Rezepte verpflichtend annehmen. Viele Kassenärztliche Vereinigungen haben jedoch nach wie vor Bedenken wegen des Datenschutzes. Wie stehen Sie dazu?
Seit dem 1. September müssen Apotheken in der Region Westfalen-Lippe E-Rezepte verpflichtend annehmen. Viele Kassenärztliche Vereinigungen haben jedoch nach wie vor Bedenken wegen des Datenschutzes. Wie stehen Sie dazu? Was heißt das konkret? Welche Vorteile entstehen für Patientinnen und Patienten durch die Bereitstellung ihrer Daten?
Was heißt das konkret? Welche Vorteile entstehen für Patientinnen und Patienten durch die Bereitstellung ihrer Daten? Sie definieren Ihre Plattform nicht nur als Service für User, sondern wollen auch Partner für lokale Anbieter sein. Inwiefern unterstützen Sie diese in ihrer Arbeit?
Sie definieren Ihre Plattform nicht nur als Service für User, sondern wollen auch Partner für lokale Anbieter sein. Inwiefern unterstützen Sie diese in ihrer Arbeit? Welche weiteren Funktionen sollen noch in die Plattform integriert werden? Gibt es konkrete Pläne?
Welche weiteren Funktionen sollen noch in die Plattform integriert werden? Gibt es konkrete Pläne?Videocredit: Getty Images/VectorFusionArt
Bildcredits: Big Bang Health/Caroline Schlüter, Big Bang Health/Michael Schwettmann, Getty Images/ipopba, PR/gesund.de