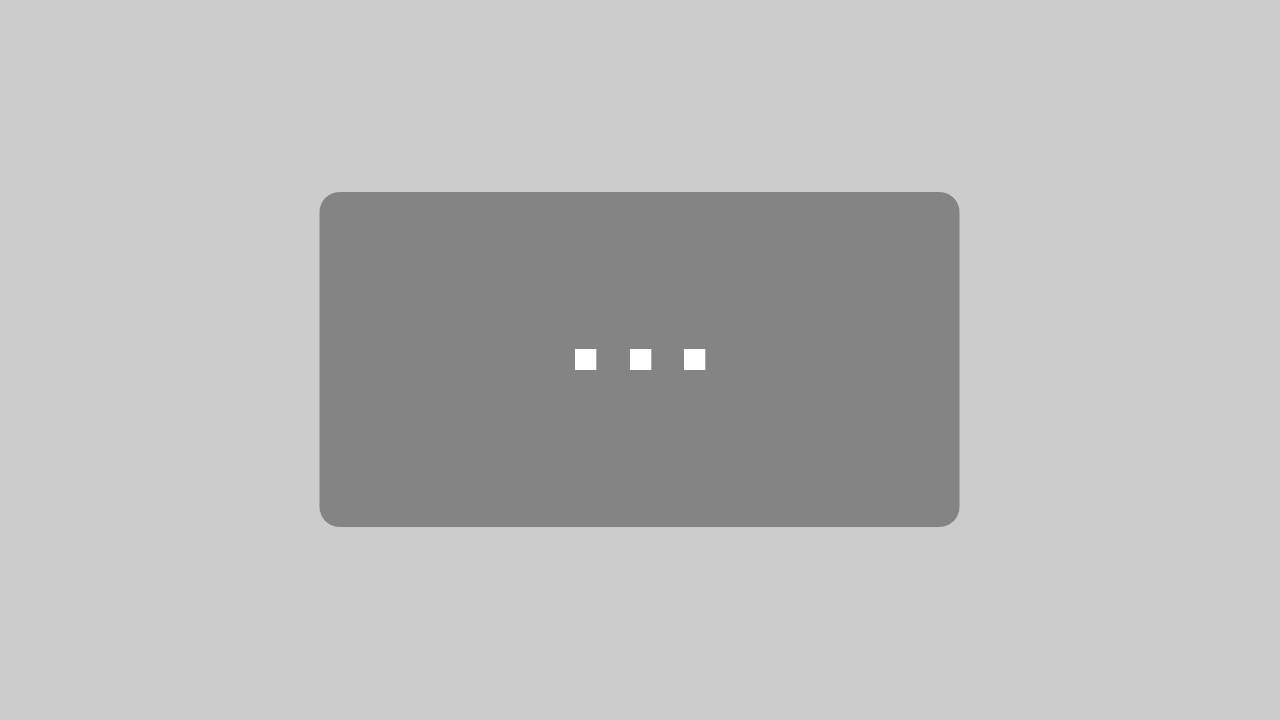E-Mobilität: Der Antrieb für die Zukunft
Damit Deutschland seine Klimaziele erreicht, muss die Verkehrswende gelingen. Der Umstieg auf alternative Antriebe, die ohne fossile Kraftstoffe auskommen, ist daher eine zwingende Notwendigkeit. Ein Blick auf den Status quo der E-Mobilität.
Der Status quo in Sachen Elektromobilität
Verbrennungsmotor, Wasserstoff, Plug-in-Hybrid oder Elektroauto: Die Auswahl an Antrieben ist groß. Aber nicht jeder ist gleich beliebt. Die Politik setzt auf Elektro – das haben auch die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP gezeigt.
Die neue Bundesregierung versteht unter Elektromobilität im Sinne des Nationalen Entwicklungsplans (NEP) „alle Fahrzeuge, die mithilfe eines Elektromotors betrieben werden und extern aufladbar sind“. Doch nicht nur die Fahrzeuge, auch das Gesamtsystem, das für die Elektromobilität notwendig ist, ist im Begriff einbezogen. Denn: E-Autos brauchen Ladestationen und Ladestationen brauchen Strom, der erst produziert werden muss ‒ und das am besten grün. Denn solange die genutzte Energie aus erneuerbaren Quellen stammt, kann der Elektroantrieb nicht nur große Effizienzvorteile mit sich bringen, sondern auch CO2-Emissionen signifikant mindern.
Wo wir beim Thema E-Mobilität stehen
Die Ziele der Politik für E-Mobilität sind hoch gesteckt. Und es bleiben lediglich neun Jahre Zeit, um diese Ziele zu erreichen. Eine Million geplante Ladestationen stehen in der Realität laut Bundesministerium für Umwelt derzeit rund 46.200 öffentlich zugänglichen Ladepunkten gegenüber. 15 Millionen zugelassene Elektrofahrzeuge strebt die Ampel-Koalition an ‒ heute fahren 516.518 rein elektrisch betriebene Pkws und 494.000 Plug-in-Hybride auf den deutschen Straßen (Stand Oktober 2021).
Am Angebot von E-Autos scheitert das Vorhaben nicht: Mehr als 70 elektrisch angetriebene Fahrzeugmodelle deutscher Autohersteller sind bereits auf dem Markt. Und auch der häufig genannten Kritik einer zu kurzen Reichweite wurde der Wind aus den Segeln genommen: So liegt die durchschnittliche Batteriereichweite 2021 bei 435 Kilometer; 2025 sollen es schon 784 Kilometer sein.
Weit fahren kann auch der Benziner, doch in Sachen Effizienz hat das Elektrofahrzeug die Nase vorn. Die Effizienz des Antriebs lässt sich anhand des Wirkungsgrads berechnen. Dieser zeigt, wie viel der eingesetzten Energie für die eigentliche Fortbewegung des Fahrzeugs genutzt wird. Bei normaler Fahrweise kommt der Benziner laut Bundesministerium für Umwelt auf rund 20 Prozent; der Rest der im Kraftstoff enthaltenen Energie geht zu großen Teilen als Abwärme verloren. Auch bei der Bereitstellung des Kraftstoffs ‒ von der Bohrung bis zur Tankstelle ‒ wird bereits eine hohe Menge an Energie verbraucht.

Sparsam unterwegs: Ein Elektroauto ist etwa dreimal so effizient wie ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor
Dagegen nutzt der Motor im Elektroauto etwa 80 Prozent der zugeführten Energie zur Fortbewegung. Werden die Verluste, die durch das Laden der Batterie und die Bereitstellung des Stroms entstehen, einbezogen, ergibt sich ein Wirkungsgrad von 64 Prozent. Das heißt also: Ein E-Auto ist dreimal so effizient wie ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Und auch im Vergleich zum Auto mit Brennstoffzelle, welche mit Wasserstoff betrieben wird, ist dieser Wert hoch: Aufgrund der aktuell noch sehr aufwendigen Herstellung von Wasserstoff liegt der Wirkungsgrad dieser Fahrzeuge bei nur 27 Prozent.
Wie klima- und umweltfreundlich ist E-Mobilität?
Die Herstellung eines Elektroautos verbraucht mehr Ressourcen als die eines Pkw mit Verbrennungsmotor. Das liegt vor allem an der Batterie. Zum einen benötigt die Produktion große Mengen an Energie, die in vielen Fällen aus Kohle- und Erdölverbrennungen gewonnen wird. Zum anderen werden für Batterien wertvolle, meist seltene Rohstoffe wie Nickel, Lithium, Graphit oder auch Kobalt verwendet. Auch der Abbau dieser Stoffe kann Umweltschäden verursachen.
Dennoch bewirkt die höhere Effizienz des elektrisch betriebenen Fahrzeugs, dass das E-Auto über die gesamte Lebensdauer im Betrieb nachhaltiger ist als andere Fahrzeuge. Selbst wenn kein Ökostrom geladen wird, ist ein E-Auto nach 60.000 Kilometern Laufleistung klimafreundlicher als ein Benziner und ab 80.000 Kilometern auch klimafreundlicher als ein Diesel. Das zeigt eine Untersuchung des ifeu-Instituts. Laut Informationen des Öko-Instituts werden über die gesamte Lebensdauer circa ein Drittel der Treibhausgas-Emissionen eingespart, wenn ein Dieselauto mit einer Laufleistung von 180.000 Kilometer durch ein vergleichbares Elektrofahrzeug ausgetauscht wird.
Die Verwendung von Ökostrom in der Produktion sowie beim Ladevorgang verbessert die Klimabilanz der Elektroautos weiter. Ebenso werden Fortschritte in der Batterieentwicklung und der Fertigungsprozesse die Nachhaltigkeit der E-Mobilität vorantreiben.
Elektromobilität ist vielfältig
Die Mobilitätswende wird jedoch nicht allein durch die privaten Pkw getragen werden können. Elektromobilität ist weit vielfältiger. Schon lange gibt es etwa die elektrischen Massenverkehrsmittel wie die S- und U-Bahnen, Trams und Trolley-Busse ‒ auch in Zukunft sind das wichtige Verkehrsträger. Und auch hier gibt es neue Entwicklungen: batteriebetriebene, Hybrid- und Brennstoffzellen-Busse beispielsweise.
Das Ziel muss eine Reduzierung von Schadstoffen sowie der Lärm-Emissionen in den Innenstädten sein. Auch E-Bikes, Pedelecs, Elektro-Roller und E-Scooter sind vor allem im städtischen Bereich bereits etabliert und werden in Sharing-Modellen genutzt. Sharing-Mobility ist aktuell, da sich das Laden eines eigenen E-Autos teils noch schwierig gestaltet und Batterien aufwendig hergestellt werden müssen, eine der nachhaltigsten Möglichkeiten E-Mobilität zu nutzen.
Zusammenarbeit statt Wettbewerb: Die Lösung?
Unglaubliche Mengen benötigter Energie, der Aufbau einer neuen Ladeinfrastruktur und die aufwendige Produktion von Batterien: Die Mobilitätswende mithilfe der Elektrofahrzeuge steht trotz vieler Vorteile des E-Antriebs vor großen Herausforderungen. Die Lösung könnte Coopetition sein – ein Trend, auf den zur Förderung des Umstiegs auf Elektromobilität in der Automobilindustrie vermehrt gesetzt wird. Statt Wettbewerb unter den Automobilherstellern heißt es nun zusammen zu arbeiten.
Während Zulieferer und Autobauer beim Verbrennungsmotor noch einen großen Anteil des Know-hows selbst inhouse besitzen, ist das bei der Herstellung von Elektrofahrzeugen anders. Denn anders als beim konventionellen Auto sind nicht mehr Motor und Getriebe von Bedeutung, sondern vor allem die Batterie. Und in diesem Bereich sind Unternehmen aus der Chemie- und Elektronikbranche bereits Jahrzehnte voraus.
Der vergleichsweise geringe Wissensstand der Automobilbranche und die damit einhergehenden Kosten zwingen sie deshalb zu engeren Kooperationen mit Lieferanten. So arbeitet beispielsweise Daimler mit dem chinesischem Batteriehersteller BYD oder Volkswagen mit Varta Microbattery zusammen. Sowohl große als auch kleine Unternehmen begeben sich in einen Kooperationswettbewerb ‒ mit dem Ziel, gemeinsam neue Konzepte für eine nachhaltigere, innovativere Zukunft der Mobilität zu entwickeln.

Der Markt hat schon entschieden
Manchmal weiß man beim Thema E-Mobilität nicht, welchen Signalen man folgen soll. Ende 2020 machte eine Studie des Vereins Deutscher Ingenieure Schlagzeilen, die zum Ergebnis kam: E-Autos sind doch nicht so klimafreundlich wie angenommen. Im Sommer 2021 hingegen stellte das renommierte International Council on Clean Transportation fest: Die Klimabilanz der Elektroautos ist knapp 70 Prozent besser als die der Verbrenner. Lohnt sich also nun die Investition in E-Autos – oder nicht?
Der Weg ist frei: E-Mobilität soll einen großen Anteil am Gelingen der Verkehrswende haben
Die Herausforderung bei der Studienlage lautet, wie so oft: Man muss genau hinschauen, was untersucht wurde. Sind es die lokalen Emissionen des Antriebs? Die produzierten Schadstoffe für die gesamte Lebensdauer – von der Produktion bis zum Abwracken oder Recycling? Geht es darum, ob E-Antriebe klimaschonender als Verbrenner sind – oder darum, um wie viel klimaschonender sie sind? In einer Sache aber sind sich Experten einig: ohne Elektrofahrzeuge keine nachhaltige Mobilität in der Zukunft.
„Die Technologie ist am weitesten, und der Markt hat sich bereits dafür entschieden“, erklärt Professor Henning Kagermann, Vorsitzender der Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität. „Es ist unumkehrbar, dass wir vom Verbrenner wegkommen müssen“, sagt auch Michael Ewert, Executive Vice President Global Sales Original Equipment beim Reifenhersteller Michelin (siehe Interview). Das heiße zwar nicht, dass der E-Antrieb die einzige Alternative ist, aber gleichwohl die aktuell beliebteste. „Wir sind für alle Technologien offen und unterstützen die Autohersteller darin, die Mobilität auf welchem Weg auch immer klimafreundlicher zu gestalten“, sagt Ewert. Wie das aussehen kann, zeige Michelin etwa in der Zusammenarbeit mit Volvo.
Nachhaltigkeit trifft auf Technologie
Der Autohersteller hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 den Verbrennungsmotoren den Rücken zu kehren. Damit ist Volvo zehn Jahre früher dran als das Bündnis aus rund 30 Staaten, Kommunen und Unternehmen (unter ihnen Volvo), die sich auf der Klimakonferenz in Glasgow darauf geeinigt haben, „zusammen daran zu arbeiten, dass alle Verkäufe neuer Autos und Kleinbusse generell bis 2040 und in führenden Märkten
nicht später als 2035 emissionsfrei sind“, wie es in der Erklärung heißt. „In Deutschland fließen ungefähr 20 Prozent der Energie, die wir nutzen, in den Pkw-Verkehr. Und diese Energie ist zu rund 95 Prozent fossil. Wir müssen also etwas tun“, sagt Lutz Stiegler, Solution Manager Electric Propulsion bei Volvo.
Doch die Entwicklung von E-Autos ist nicht nur eine Frage des Antriebs. Auch andere Teile müssen angepasst werden – etwa die Reifen. Deshalb arbeitet Volvo schon im frühen Stadium der Entwicklung mit seinen Zulieferern zusammen. Die Fahrzeugentwicklung sei aber nur eine Seite, so Stiegler. „Wie schnell sich die Elektromobilität etabliert, wird davon abhängen, wie das Thema Ladesäulen forciert wird.“ Ewert positioniert sich klar: „Es wäre ein Armutszeugnis, wenn es an der Ladeinfrastruktur scheitert.“
Mobiltät als Gesamtkonzept
Aber passen die Rahmenbedingungen? Die Bundesregierung habe das Thema erfolgreich subventioniert, so Kagermann. Ein Beispiel: „Allein im privaten Bereich hat die Politik rund 620.000 Wallboxen gefördert. Das ist schon ein Erfolg.“ Doch wenn die flächendeckende Ladeinfrastruktur in Deutschland bis 2025 – so das Ziel – kommen soll, sind auch andere Player gefragt: Automobilhersteller, Produzenten von Ladesäulen, Netzwerkanbieter, die Leitungen legen, und Mineralölfirmen, die neue Tankstellen entwickeln.
„Es geht um ein neues Gesamtkonzept für Mobilität. Alle Stakeholder müssen mitspielen“, so Stiegler. Dabei nicht zu vergessen sei die Digitalisierung. „Nicht nur der Antrieb wird die Zukunft entscheiden, auch die Software-Entwicklung“, sagt Kagermann. Schon jetzt kämen vermehrt neue Player in den Markt, etwa Google und Apple, die Autos entwickeln. Auf den wachsenden Bedarf an Vernetzung stellt sich Michelin bereits ein. „Wir rüsten bis 2024 alle Reifen mit RFID-Chips aus, um Konnektivität herzustellen“, sagt Ewert. „Wir erleben gerade einen Innovationsschub. Mit E-Autos sind wir schon auf dem richtigen Weg.“
Von Autohersteller über Zulieferer: Was der Umstieg auf E-Mobilität für Zulieferer und Hersteller bedeutet
Die Sicht des Zulieferers
 Welchen Einfluss haben E-Antriebe auf die Entwicklung und Produktion von Reifen?
Welchen Einfluss haben E-Antriebe auf die Entwicklung und Produktion von Reifen? Inwiefern spielt das Geräusch eine Rolle?
Inwiefern spielt das Geräusch eine Rolle? Welche Rolle spielen Recycling und Kreislaufwirtschaft?
Welche Rolle spielen Recycling und Kreislaufwirtschaft?
Vorfahrt für E-Autos

„Deutschland hat noch Nachholbedarf. Aber in den letzten ein, zwei Jahren ist hinsichtlich der Elektromobilität einiges passiert.“
Alexander Klein, Vice President Development of Climate and Environmental Financial Products for Corporates, KfW
Das Auto ist nach wie vor der Deutschen liebstes Kind. Ob Mercedes, VW oder BMW – das eigene Auto steht für Freiheit, Lebensfreude und Mobilität. Allerdings trägt der Verkehr einen erheblichen Teil zum gesamten CO2-Ausstoß und damit zur Erderwärmung bei. Deshalb muss die Verkehrswende, die Transformation des Mobilitätssektors, gelingen. Das bedeutet das Aus für Diesel und Benzin.
Doch wie weit ist Deutschland auf dem Weg dorthin? „In Sachen Umstieg auf E-Mobilität hinken wir dem Ausland nicht weit hinterher“, sagt Zukunftsforscher Sven Gábor Jánszky im DUP Digital Business Talk. „Deutschland hat noch Nachholbedarf. Aber in den letzten ein, zwei Jahren ist hinsichtlich der Elektromobilität einiges passiert“, so Alexander Klein, Vice President Development of Climate and Environmenal Financial Products for Corporates bei der Förderbank KfW in Frankfurt am Main. „Wir sind noch nicht dort, wo wir hinwollen, aber auf dem Weg. Wir rechnen für die nächsten 30 Jahre mit Investitionen in die Mobilitätswende in Höhe von 150 Milliarden Euro.“
Markus Emmert, Vorstand beim Bundesverband eMobilität, gibt zu bedenken: „Wir sprechen über CO2-freie Mobilität. Das bedeutet, dass wir genauso viel in den Ausbau der erneuerbaren Energien investieren müssen. Denn ohne diese kann die Verkehrswende nicht gelingen.“
Mehr kleinere E-Modelle notwendig
Auch muss das Interesse breiterer Schichten an E-Mobilität geweckt werden. Das KfW-Energiewendebarometer – eine jährliche Erhebung der Förderbank unter rund 4.000 Haushalten zum aktuellen und künftigen Einsatz energiewenderelevanter Technologien – erbrachte 2021, „dass der größere Anteil derjenigen, die sich ein Elektrofahrzeug zulegen, zu den Haushalten mit höherem Einkommen zählen“, sagt Klein.

„Die Ladeinfrastruktur muss auch E-Roller und E-Bikes unbedingt mit einschließen.“
Markus Emmert, Vorstand, Bundesverband eMobilität
Soll der gesamte Verkehr elektrifiziert werden, müssen aber alle mitgenommen werden, so Klein weiter. Die Fahrzeuge seien derzeit so teuer, weil vor allem in hochklassige Modelle wie SUVs & Co. investiert werde, betont Emmert. „Wir müssen dafür sorgen, dass auch viel mehr kleinere Modelle voll elektrifiziert werden.“ Diese würden dann angesichts der hohen Zuschüsse auch für Haushalte mit einem niedrigen Einkommen erschwinglich.
E-Autos fürs Identitätsmanagement
Dass teurere Wagen wie etwa Tesla solchen Erfolg haben, erklärt Zukunftsforscher Jánszky damit, dass das obere Kfz-Segment in einen Bereich fällt, „den wir Identitätsmanagement nennen“. Attribute wie „beste Qualität“ oder „höchster Preis“ rückten in den Hintergrund. Der Kundenwunsch, mit einem Fahrzeug eine positive Identität auszudrücken, werde stärker. Produkte, Unternehmens- und Personenmarken gewännen als Identitätsträger an Gewicht. „Wir wollen damit zeigen, dass wir etwas Besonderes sind“, so Jánszky.

„Das obere Kfz-Segment fällt in einen Bereich, den wir Identitätsmanagement nennen.“
Sven Gábor Jánszky, Zukunftsforscher
Die klassischen Hersteller hätten nur zwei Identitäten bedient, um zeigen zu können: „Ich bin reich“ und „Ich rase gern“. Tesla-Käufer würden heute aber demonstrieren wollen, dass sie leise und „öko“ seien – und sie wollen ihr Silicon-Valley-Mindset präsentieren. Emmert sagt: „Tesla hat es geschafft, aus einem Auto ein Lifestyle-Produkt zu machen.“ Und Klein ergänzt: „Das hört sich wie die Apple-Story an.“
Ladeinfrastruktur breit auslegen
Bei aller Begeisterung für E-Autos warnen die Experten aber auch vor der ausschließlichen Konzentration auf die Elektrifizierung. „Die Verkehrswende und die Klimaziele werden wir nicht allein durch den Wechsel von Benzin und Diesel hin zur Elektrifizierung schaffen. Die Ladeinfrastruktur muss zum Beispiel auch E-Roller und E-Bikes unbedingt mit einschließen“, sagt Emmert. In Zukunft seien insbesondere Mega-Citys dazu gezwungen, die Autos aus den Innenstädten zu drängen. „Sonst stehen wir nur noch im Stau.“
Jánszky prophezeit: „Es wird auch 2030 noch Autos in den Zentren geben, aber es werden viel weniger Privatautos sein.“ Es würden zunehmend Robo-Taxi-Flotten sein, also Fahrzeuge, die autonom fahren. Weltweit gebe es bereits heute drei zugelassene Flotten von Robo-Taxis im Regelbetrieb; in München werde eine im nächsten Jahr den Testbetrieb aufnehmen. Solche Angebote würden die Stadtbilder im Jahr 2030 prägen.
Mobilitätsroundtable: Experten geben Einblicke in die Zukunft der Mobilität
Und damit ließe sich zudem Geld sparen: Wird eine Strecke mit dem Privatwagen zurückgelegt, liegen die Kosten laut Berechnungen von Tesla circa fünfmal höher als bei der Nutzung eines Robo-Taxis. Zukunftsforscher Jánszky: „Wir brauchen diese kostengünstige Alternative und müssen alles dafür tun, dass es sie so schnell wie möglich gibt.“ Dann würden auch die gesellschaftlichen und politischen Diskussionen leichter fallen, den Verkehr von Privat-Pkw in den Städten zu begrenzen. Für Emmert ist der Weg dorthin die Elektrifizierung der privaten Fahrzeuge. Dies müsse aber auch durch neue Verkehrskonzepte und eine deutliche Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs flankiert werden.
Bürokratische Hürden abbauen
Dafür bestünden in Deutschland allerdings viele Hürden. Beispiel: die Planfeststellungsverfahren, etwa für das Verlegen neuer Schienentrassen. Diese benötigten in Deutschland „zig Jahre, in China dauert so etwas nur ein halbes Jahr“, so Emmert.
KfW-Experte Klein geht in Sachen Elektrifizierung noch einen Schritt weiter: „Ich würde mich auch in ein Flugtaxi setzen, wenn ich darin auf dem Weg ins Büro arbeiten könnte.“

Förderkredite für grüne Investments
Manche Länder, wie etwa Norwegen, sind Deutschland bei der Elektrifizierung des Verkehrs weit voraus. Um aufzuholen und die Klimaziele zu erreichen, greifen die Politiker tief ins Staatssäckel. Mit Zinssätzen nahe null Prozent auf Förderkredite und Zuschüssen soll auch der Mittelstand schneller umrüsten. Alexander Klein, der bei der KfW Förderprogramme für Firmen entwickelt, erklärt die Details.
Deutschlands industrielle Herzkammer befindet sich in einem Umbruch von historischen Dimensionen. Die Automobilindustrie geht neue Wege – mit eigener Dynamik, aber auch angetrieben von externen Impulsen. Zwar sind die Hersteller besser aus der pandemiebedingten Krise gekommen als erwartet, doch die Herausforderungen bleiben.
Angefangen bei den Lieferketten: Die Pandemie hat deren Volatilität aufgezeigt – und selbst der wirtschaftliche Aufschwung kann die daraus resultierenden Probleme, sprich die mangelnde Verfügbarkeit wichtiger Rohstoffe, nicht kaschieren. Allein die Chip-Knappheit werde dem Beratungshaus Alix Partners zufolge in Europa zu einem Produktionsausfall von bis zu vier Millionen Fahrzeugen führen. Übergeordnet dominieren daneben weiterhin die beiden Megatrends Nachhaltigkeit und Digitalisierung, denen sich Autobauer sowie Zulieferer gleichermaßen stellen müssen.
Autobauer oder Softwareschmieden?
Alle Faktoren zusammen wirken als Beschleuniger der Transformation. In der Praxis stellen sich Fragen: ob es noch sinnvoll ist, Autos mit Verbrennungsmotor zu produzieren, ob der alleinige Fokus auf E-Mobilität der richtige ist, welche Rolle synthetische Kraftstoffe spielen und wo grün erzeugter Wasserstoff zum Einsatz kommen kann.
„Wie hältst du es mit dem Klimaschutz?“ – das ist längst zur Gretchenfrage für die Industrie geworden. Das Ob hingegen steht längst nicht mehr zur Diskussion. Dafür sorgen die gesetzliche Regulatorik und das öffentliche Interesse.
Die zweite entscheidende Weichenstellung: Braucht es künftig überhaupt noch Autobauer, oder sind nicht eher Softwareschmieden gefragt? Oder ist am Ende die Fusion beider am zielführendsten? Denn Vernetzung, intelligente Assistenzsysteme, autonomes Fahren, digitale Geschäftsmodelle: All diese Aspekte entscheiden in Zukunft über den Erfolg. Gerade auch vor dem Hintergrund neuer Player, die sich – oftmals technologiegetrieben – aufgemacht haben, den einst verteilt geglaubten Markt zu disruptieren.
Die Sharing Economy und Trends wie Urbanisierung und ein anderes Konsumbedürfnis tun ihr Übriges, um den Wandel auch aufseiten der Kundinnen und Kunden zu forcieren. Die großen Automobilkonzerne sind hier ebenso gefordert wie ihre Pendants auf Technologieseite – die Start-ups –, die Wissenschaft und natürlich die einen Rahmen setzende Politik.
Trend 1: Autonom fahren und fliegen
Autonomes Fahren ist keine Zukunftsvision mehr, sondern Teil unserer Realität. Die erste Stufe der Autonomie, das assistierte Fahren, kennen viele Autohalter bereits aus der täglichen Praxis. Von Spurhalte- und Bremsassistenten sowie Abstandshaltern über automatisches Einparken bis hin zum Tempomat: All das gehört in die Kategorie autonomes Fahren. Grundsätzlich werden dabei fünf Stufen unterschieden: assistiert, teilautomatisiert, hochautomatisiert, vollautomatisiert und schließlich autonom. Und Letzteres wird weltweit bereits vielerorts erprobt.
Hoch hinaus: Mit dem Flugtaxi von A nach B – das ist ein Ziel, an dem gerade viele Start-ups und Konzerne arbeiten
Autonome Flugtaxis bald Realität?
So hat die General-Motors-Tochterfirma Cruise erst kürzlich ein selbstständig fahrendes Auto – ganz ohne Sicherheitsfahrer – in San Francisco eingesetzt. Auf der Testfahrt machte sich das Robotaxi gut: An roten Ampeln blieb es stehen; einen einparkenden Lastwagen erkannte das Fahrzeug und wartete entsprechend bis zur Weiterfahrt. Zur Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer finden Testfahrten wie diese aktuell noch nachts bei wenig Verkehr und mit nur rund 48 km/h statt.
Und während die einen noch mit dem wie von Geisterhand von allein rollenden Automobil beschäftigt sind, träumen andere schon vom autonomen Flugtaxi. Mit dieser Idee befassen sich immer mehr Unternehmen; das Wettrennen um das erste kommerzielle Angebot ist längst in vollem Gange. Neben Start-ups wie Volocopter, Joby oder Lilium arbeiten auch Unternehmen wie Airbus und Volkswagen an fliegenden Verkehrsmitteln.
Das deutsche Unternehmen Volocopter liegt derzeit besonders gut im Rennen und plant innerhalb der nächsten zwei Jahre die ersten Angebote. Staus auf Autobahnen ausweichen und dicht befahrene Innenstädte vermeiden könnte demnach schon bald Realität werden. Expertinnen und Experten schätzen den Marktwert von elektronischen Flugtaxis auf mehr als 1,5 Billionen Dollar im Jahr 2040.
Trend 2: Alternative Antriebe
Abgesehen von der Umweltbelastung lassen aktuell allein die steigenden Ölpreise sowie die Erhöhung der CO2-Steuer das Fahren eines Verbrenners beinah zum Luxushobby avancieren. Eine Förderung vom Staat, die den Kauf eines Elektroautos mit Prämien verbilligt, ist ein zusätzlicher Anreiz umzusteigen. Bis Ende September 2021 wurden in Deutschland eine halbe Million E-Autos neu zugelassen. Hersteller wie Audi setzen längst auf die E-Strategie: Bis 2032 will die Marke ausschließlich rein batterieelektrische Modelle verkaufen.
E-Antrieb ist nicht alles
Doch ist das Elektroauto die eine Lösung für den Antriebsmix der Zukunft? Mitnichten, finden Hersteller wie Toyota. Der japanische Konzern setzt auf eine Mischung aus Vollhybrid, Plug-in-Hybrid, Elektro und Wasserstoff – für jede Anforderung die passende Technologie. Und auch BMW bleibt technologieoffen und forscht weiter an der Alternative Wasserstoff. Erzeugt aus erneuerbaren Energien, hinterlässt dieser garantiert einen grünen Fußabdruck. Zwar ist die Tankstellen-Infrastruktur noch ausbaufähig, doch es tut sich etwas. Ein Umdenken beginnt beziehungsweise ist bereits in vollem Gange.
Trend 3: Konnektivität
Das vernetzte Auto wird die Mobilität der Zukunft prägen. Intelligente Systeme, die automatisch eine Route ändern, um Staus zu vermeiden, die vor nassen Straßen oder nahenden Radfahrern warnen, die Hinweise zu platten Reifen geben oder das Auto in die Spur zurückmanövrieren, gibt es bereits. Einige Fahrzeugmodelle sind bereits heute mit mehr als 50 Konnektivitätsfunktionen ausgestattet.
Vernetzt unterwegs: Die Autos der Zukunft sind softwaregesteuert
Alles kommuniziert mit allem
Eine der wichtigsten Funktionen, die seit 2018 EU-weit in allen neuen Pkw Pflicht ist: das Notrufsystem E-Call. Mithilfe von Mobilfunk und Satellitenortung alarmiert es nach einem Unfall automatisch den Rettungsdienst. Dadurch soll die Zahl der Verkehrstoten reduziert werden. Fakt ist: Die Autos der Zukunft sind softwaregesteuert. Sie kommunizieren mit der Fahrerin oder dem Fahrer sowie mit anderen Verkehrsteilnehmenden, aber auch der Infrastruktur etwa in der Smart City. Die Konnektivität hat vor allem ein Ziel: die Sicherheit im Verkehr zu verbessern. Zugleich haben die diversen Anwendungen aber auch das Potenzial, das Autofahren zu revolutionieren.
Trend 4: Teilen statt besitzen
In den Ballungsräumen boomt der Sharing-Markt. E-Scooter, Roller, Carsharing, Fahrräder oder On-Demand-Dienste wie MOIA und Uber: Das Angebot an bedarfsgerecht verfügbaren Mobilitätslösungen ist vielfältig. Die Folge: Das einst fest gefügte Bild vom Auto als Statussymbol ist – zumindest im urbanen Raum und bei jüngeren Generationen – ins Wanken geraten. Auf dem Land sieht das allerdings aufgrund fehlender Alternativen nach wie vor anders aus.
Auch Autos gibt es im Abo
Ralph Rase ist Head of Mobility & Innovation Division bei KINTO. Der Mobilitätsdienstleister gehört zu Toyota und bietet unter anderem stationsbasiertes Carsharing sowie Auto-Abos an. In Letzterem sieht Rase großes Potenzial (siehe Interview rechts). Ein Angebot dieser Art wurde erstmals 2019 auf der IAA vom Start-up ViveLaCar präsentiert. Die Idee dahinter: Bis zu drei Haushalte können sich ein Auto teilen – zu einem monatlichen individuell berechneten Preis für jeden Nutzer. So könnte nicht nur das eigene Portemonnaie entlastet, sondern auch die Parkplatzsituation in vielen Großstädten verbessert werden.
 Die KfW unterstützt Unternehmen im Rahmen der „Klimaschutzoffensive für den Mittelstand“ auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Wer hat Anspruch auf diese Förderung?
Die KfW unterstützt Unternehmen im Rahmen der „Klimaschutzoffensive für den Mittelstand“ auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Wer hat Anspruch auf diese Förderung? Für welche Maßnahmen gibt es diese Kredite?
Für welche Maßnahmen gibt es diese Kredite? Und was kosten die Kredite?
Und was kosten die Kredite? Die Unternehmer bekommen also Geld geschenkt?
Die Unternehmer bekommen also Geld geschenkt? Mal ganz konkret: Wie sieht die Rechnung aus, wenn ein Unternehmer für seinen Fuhrpark drei E-Dienstwagen für insgesamt 100.000 Euro kauft?
Mal ganz konkret: Wie sieht die Rechnung aus, wenn ein Unternehmer für seinen Fuhrpark drei E-Dienstwagen für insgesamt 100.000 Euro kauft? Geht noch mehr Unterstützung?
Geht noch mehr Unterstützung? Wie beantragen Unternehmer einen KfW-Kredit?
Wie beantragen Unternehmer einen KfW-Kredit?Mobilität geht ganz anders
Deutschlands industrielle Herzkammer befindet sich in einem Umbruch von historischen Dimensionen. Die Automobilindustrie geht neue Wege – mit eigener Dynamik, aber auch angetrieben von externen Impulsen. Zwar sind die Hersteller besser aus der pandemiebedingten Krise gekommen als erwartet, doch die Herausforderungen bleiben.
Angefangen bei den Lieferketten: Die Pandemie hat deren Volatilität aufgezeigt – und selbst der wirtschaftliche Aufschwung kann die daraus resultierenden Probleme, sprich die mangelnde Verfügbarkeit wichtiger Rohstoffe, nicht kaschieren. Allein die Chip-Knappheit werde dem Beratungshaus Alix Partners zufolge in Europa zu einem Produktionsausfall von bis zu vier Millionen Fahrzeugen führen. Übergeordnet dominieren daneben weiterhin die beiden Megatrends Nachhaltigkeit und Digitalisierung, denen sich Autobauer sowie Zulieferer gleichermaßen stellen müssen.
Autobauer oder Softwareschmieden?
Alle Faktoren zusammen wirken als Beschleuniger der Transformation. In der Praxis stellen sich Fragen: ob es noch sinnvoll ist, Autos mit Verbrennungsmotor zu produzieren, ob der alleinige Fokus auf E-Mobilität der richtige ist, welche Rolle synthetische Kraftstoffe spielen und wo grün erzeugter Wasserstoff zum Einsatz kommen kann.
„Wie hältst du es mit dem Klimaschutz?“ – das ist längst zur Gretchenfrage für die Industrie geworden. Das Ob hingegen steht längst nicht mehr zur Diskussion. Dafür sorgen die gesetzliche Regulatorik und das öffentliche Interesse.
Die zweite entscheidende Weichenstellung: Braucht es künftig überhaupt noch Autobauer, oder sind nicht eher Softwareschmieden gefragt? Oder ist am Ende die Fusion beider am zielführendsten? Denn Vernetzung, intelligente Assistenzsysteme, autonomes Fahren, digitale Geschäftsmodelle: All diese Aspekte entscheiden in Zukunft über den Erfolg. Gerade auch vor dem Hintergrund neuer Player, die sich – oftmals technologiegetrieben – aufgemacht haben, den einst verteilt geglaubten Markt zu disruptieren.
Die Sharing Economy und Trends wie Urbanisierung und ein anderes Konsumbedürfnis tun ihr Übriges, um den Wandel auch aufseiten der Kundinnen und Kunden zu forcieren. Die großen Automobilkonzerne sind hier ebenso gefordert wie ihre Pendants auf Technologieseite – die Start-ups –, die Wissenschaft und natürlich die einen Rahmen setzende Politik.
Trend 1: Autonom fahren und fliegen
Autonomes Fahren ist keine Zukunftsvision mehr, sondern Teil unserer Realität. Die erste Stufe der Autonomie, das assistierte Fahren, kennen viele Autohalter bereits aus der täglichen Praxis. Von Spurhalte- und Bremsassistenten sowie Abstandshaltern über automatisches Einparken bis hin zum Tempomat: All das gehört in die Kategorie autonomes Fahren. Grundsätzlich werden dabei fünf Stufen unterschieden: assistiert, teilautomatisiert, hochautomatisiert, vollautomatisiert und schließlich autonom. Und Letzteres wird weltweit bereits vielerorts erprobt.
Hoch hinaus: Mit dem Flugtaxi von A nach B – das ist ein Ziel, an dem gerade viele Start-ups und Konzerne arbeiten
Autonome Flugtaxis bald Realität?
So hat die General-Motors-Tochterfirma Cruise erst kürzlich ein selbstständig fahrendes Auto – ganz ohne Sicherheitsfahrer – in San Francisco eingesetzt. Auf der Testfahrt machte sich das Robotaxi gut: An roten Ampeln blieb es stehen; einen einparkenden Lastwagen erkannte das Fahrzeug und wartete entsprechend bis zur Weiterfahrt. Zur Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer finden Testfahrten wie diese aktuell noch nachts bei wenig Verkehr und mit nur rund 48 km/h statt.
Und während die einen noch mit dem wie von Geisterhand von allein rollenden Automobil beschäftigt sind, träumen andere schon vom autonomen Flugtaxi. Mit dieser Idee befassen sich immer mehr Unternehmen; das Wettrennen um das erste kommerzielle Angebot ist längst in vollem Gange. Neben Start-ups wie Volocopter, Joby oder Lilium arbeiten auch Unternehmen wie Airbus und Volkswagen an fliegenden Verkehrsmitteln.
Das deutsche Unternehmen Volocopter liegt derzeit besonders gut im Rennen und plant innerhalb der nächsten zwei Jahre die ersten Angebote. Staus auf Autobahnen ausweichen und dicht befahrene Innenstädte vermeiden könnte demnach schon bald Realität werden. Expertinnen und Experten schätzen den Marktwert von elektronischen Flugtaxis auf mehr als 1,5 Billionen Dollar im Jahr 2040.
Antriebsmix: Neben Elektro werden auch Technologien wie Vollhybrid, Plug-in-Hybrid und Wasserstoff eine entscheidende Rolle spielen
Trend 2: Alternative Antriebe
Abgesehen von der Umweltbelastung lassen aktuell allein die steigenden Ölpreise sowie die Erhöhung der CO2-Steuer das Fahren eines Verbrenners beinah zum Luxushobby avancieren. Eine Förderung vom Staat, die den Kauf eines Elektroautos mit Prämien verbilligt, ist ein zusätzlicher Anreiz umzusteigen. Bis Ende September 2021 wurden in Deutschland eine halbe Million E-Autos neu zugelassen. Hersteller wie Audi setzen längst auf die E-Strategie: Bis 2032 will die Marke ausschließlich rein batterieelektrische Modelle verkaufen.
E-Antrieb ist nicht alles
Doch ist das Elektroauto die eine Lösung für den Antriebsmix der Zukunft? Mitnichten, finden Hersteller wie Toyota. Der japanische Konzern setzt auf eine Mischung aus Vollhybrid, Plug-in-Hybrid, Elektro und Wasserstoff – für jede Anforderung die passende Technologie.
Und auch BMW bleibt technologieoffen und forscht weiter an der Alternative Wasserstoff. Erzeugt aus erneuerbaren Energien, hinterlässt dieser garantiert einen grünen Fußabdruck. Zwar ist die Tankstellen-Infrastruktur noch ausbaufähig, doch es tut sich etwas. Ein Umdenken beginnt beziehungsweise ist bereits in vollem Gange.
Trend 3: Konnektivität
Das vernetzte Auto wird die Mobilität der Zukunft prägen. Intelligente Systeme, die automatisch eine Route ändern, um Staus zu vermeiden, die vor nassen Straßen oder nahenden Radfahrern warnen, die Hinweise zu platten Reifen geben oder das Auto in die Spur zurückmanövrieren, gibt es bereits. Einige Fahrzeugmodelle sind bereits heute mit mehr als 50 Konnektivitätsfunktionen ausgestattet.
Vernetzt unterwegs: Die Autos der Zukunft sind softwaregesteuert
Alles kommuniziert mit allem
Eine der wichtigsten Funktionen, die seit 2018 EU-weit in allen neuen Pkw Pflicht ist: das Notrufsystem E-Call. Mithilfe von Mobilfunk und Satellitenortung alarmiert es nach einem Unfall automatisch den Rettungsdienst. Dadurch soll die Zahl der Verkehrstoten reduziert werden. Fakt ist: Die Autos der Zukunft sind softwaregesteuert.
Sie kommunizieren mit der Fahrerin oder dem Fahrer sowie mit anderen Verkehrsteilnehmenden, aber auch der Infrastruktur etwa in der Smart City. Die Konnektivität hat vor allem ein Ziel: die Sicherheit im Verkehr zu verbessern. Zugleich haben die diversen Anwendungen aber auch das Potenzial, das Autofahren zu revolutionieren.
Trend 4: Teilen statt besitzen
In den Ballungsräumen boomt der Sharing-Markt. E-Scooter, Roller, Carsharing, Fahrräder oder On-Demand-Dienste wie MOIA und Uber: Das Angebot an bedarfsgerecht verfügbaren Mobilitätslösungen ist vielfältig. Die Folge: Das einst fest gefügte Bild vom Auto als Statussymbol ist – zumindest im urbanen Raum und bei jüngeren Generationen – ins Wanken geraten. Auf dem Land sieht das allerdings aufgrund fehlender Alternativen nach wie vor anders aus.
Mobilitätskonzepte: Sharing-Angebote und andere Mobilitätsdienste werden künftig attraktiver
Auch Autos gibt es im Abo
Ralph Rase ist Head of Mobility & Innovation Division bei KINTO. Der Mobilitätsdienstleister gehört zu Toyota und bietet unter anderem stationsbasiertes Carsharing sowie Auto-Abos an.
In Letzterem sieht Rase großes Potenzial (siehe Interview unten). Ein Angebot dieser Art wurde erstmals 2019 auf der IAA vom Start-up ViveLaCar präsentiert.
Die Idee dahinter: Bis zu drei Haushalte können sich ein Auto teilen – zu einem monatlichen individuell berechneten Preis für jeden Nutzer. So könnte nicht nur das eigene Portemonnaie entlastet, sondern auch die Parkplatzsituation in vielen Großstädten verbessert werden.

Autos im Abo: Bequemlichkeit siegt
 Sie bieten stationsbasiertes Carsharing an. Warum setzen Sie nicht auf Freefloating? Das Auto abstellen, wo man will, gibt doch mehr Freiheiten.
Sie bieten stationsbasiertes Carsharing an. Warum setzen Sie nicht auf Freefloating? Das Auto abstellen, wo man will, gibt doch mehr Freiheiten. Arbeiten Sie nur mit Toyota zusammen?
Arbeiten Sie nur mit Toyota zusammen? Ein weiteres Standbein von KINTO: Auto-Abos. Nun gilt das Auto gemeinhin als der Deutschen liebstes Kind. Ist es vorstellbar, dass die Mehrheit hierzulande in absehbarer Zeit kein Auto mehr besitzt, sondern für eine monatliche Gebühr das Fahrzeug nutzt, das gerade als passend empfunden wird?
Ein weiteres Standbein von KINTO: Auto-Abos. Nun gilt das Auto gemeinhin als der Deutschen liebstes Kind. Ist es vorstellbar, dass die Mehrheit hierzulande in absehbarer Zeit kein Auto mehr besitzt, sondern für eine monatliche Gebühr das Fahrzeug nutzt, das gerade als passend empfunden wird? Videocredit: Getty Images/gorodenkoff, Getty Images/denkcreative, Getty Images/ConceptCafe, Getty Images/Serhii Brovko, Getty Images/Oleksandr Hruts, Getty Images/motionxcom
Bildcredits: Getty Images/Martin Dimitrov, Credit: Getty Images/Fritz Jorgensen, Getty Images/frankpeters, Getty Images/gorodenkoff, PR, Getty Images/Tero Vesalainen