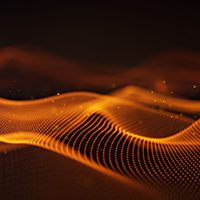Julian Specht hatte Glück. Er musste sich 2015 einer Hirn-OP unterziehen, um seine epileptischen Anfälle in den Griff zu bekommen. Anfälle hat er seitdem nicht mehr, kognitive Einschränkungen sind von der OP auch nicht geblieben. Zum Glück. Denn die Therapiemöglichkeiten, von denen seine Ärztinnen und Ärzte vor dem Eingriff berichteten, haben ihn nicht sonderlich überzeugt.
Mithilfe von Stift, Papier und abstrakten, realitätsfernen Übungen nach einer Hirn-OP, einem Schlaganfall oder Unfall wieder in den Alltag zurückfinden – das klang für Specht nicht nach moderner, zeitgemäßer Neuro-Rehabilitation. Und so begann er noch während des Studiums gemeinsam mit seiner Kommilitonin Barbara Stegmann damit, etwas Neuartiges zu entwickeln.
Das Ergebnis: die Software teora mind. In Kombination mit einer VR-Brille werden damit alltägliche Situationen im virtuellen Raum geübt.