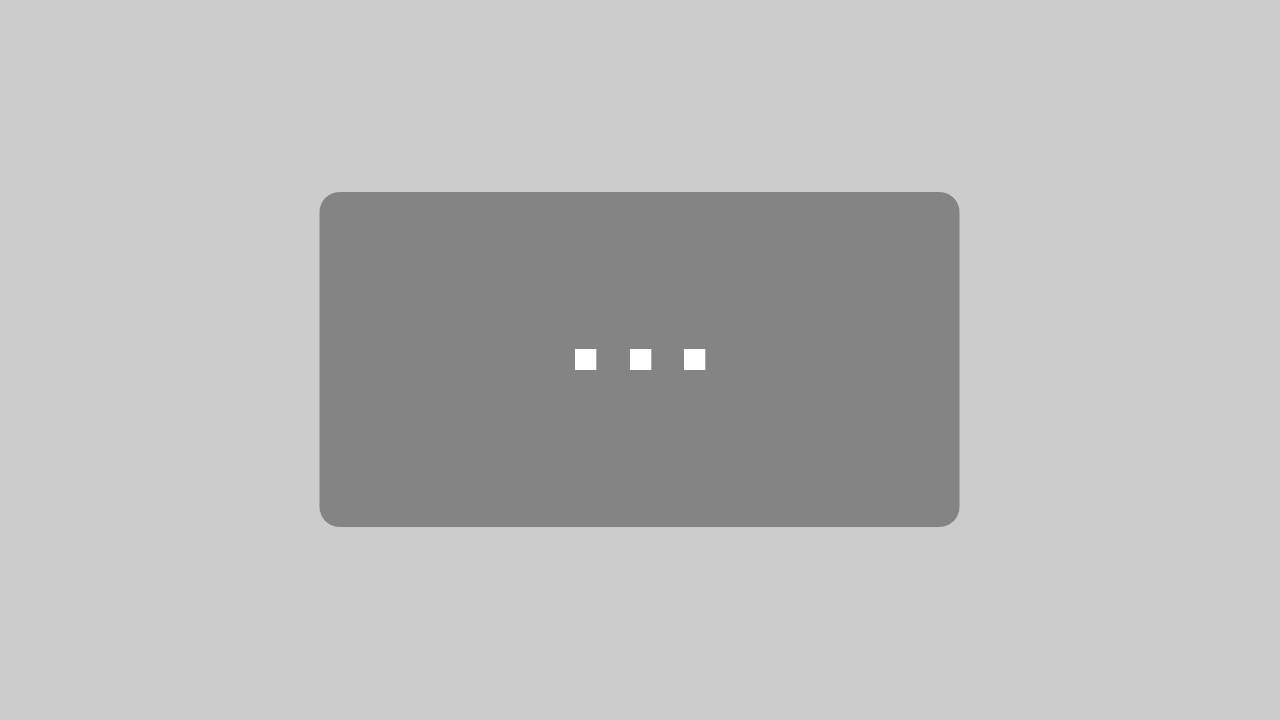Deep Tech: Der Status quo in Europa
Der Begriff Deep Tech bezeichnet disruptive Lösungen, die durch den beschleunigten technologischen Wandel und massive Fortschritte in der Wissenschaft möglich werden. Sie bieten Unternehmen die Möglichkeit, bahnbrechende Innovationen hervorzubringen.
Deep Tech: Aufbruch in neue Sphären
Die Entwicklung wird immer rasanter; alles wird immer komplexer, immer vernetzter. Die fortschreitende digitale Transformation schafft permanent neue technologische Möglichkeiten. Die nächste industrielle Revolution ist in vollem Gange – denn jetzt verschmelzen in der vierten industriellen Revolution (4IR) dank Deep Tech die physische, die digitale und die biologische Welt miteinander. Doch was bedeutet das? Und was heißt eigentlich Deep Tech?
„Der Begriff bezeichnet Lösungen, die auf gänzlich neuen wissenschaftlichen Grundlagen beruhen, höchst innovativ sind und neue Standards am Markt setzen“, lautet die einfache Erklärung des German Deep Tech Institute, das sich auf den Wissenstransfer zwischen Forschung und unternehmerischer Praxis fokussiert. Gelingt dieses ambitionierte Vorhaben, könnte dem Mittelstand ein goldenes Zeitalter bevorstehen: die Deep-Tech-Ära.
Europa sucht bei Deep Tech den Anschluss
Auch die Politik hat das Potenzial von Deep Tech erkannt. „Vom Internet der Dinge über Cloud-Computing und 5G bis hin zu Künstlicher Intelligenz – Innovationen in intelligenten vernetzten Technologien verändern den Status quo weltweit in rasantem Tempo. Kleine, aber hoch innovative europäische Unternehmen können Europas Wettbewerbsposition bei den digitalen Technologien entscheidend stärken“, sagte António Campinos, Präsident des Europäischen Patentamts, bei der Vorstellung einer neuen Studie des Europäischen Patentamts und der Europäischen Investitionsbank zu Deep-Tech-Innovationen.
Die Studienautoren kommen allerdings zu der Erkenntnis, dass aktuell kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) in den USA einen höheren Beitrag zur Innovation bei Technologien leisten als KMU in der Europäischen Union. Dadurch werde die Führungsrolle der USA bei hoch entwickelten digitalen Technologien weiter gestärkt. Use-Cases für Deep-Tech-Innovationen gibt es derzeit vor allem im Gesundheitswesen, im Verkehrssektor, im Bereich der Umwelttechnologien und bei der Datenanalyse.
Interessant: Deep Tech ist ein Thema für KMU. Denn laut Studie haben rund 80 Prozent der Deep-Tech-Unternehmen in der EU maximal 50 Mitarbeitende. Fast 60 Prozent üben ihre Geschäftstätigkeit bereits seit mehr als zehn Jahren aus. Denn: Die Entwicklungszyklen im Hochtechnologiebereich sind deutlich länger als bisher.
Biontech hat gezeigt, was möglich ist
Ein prominentes deutsches Beispiel dafür, dass sich jahrelange Spitzenforschung irgendwann finanziell auszahlen kann, ist der Mainzer Pharmakonzern Biontech. Die Gründer Uğur Şahin, Özlem Türeci und Christoph Huber forschten seit 2008 zur Entwicklung von Technologien und zur Herstellung von Medikamenten für individualisierte Krebsimmuntherapien auf mRNA-Basis.
Der entscheidende Durchbruch in der Krebstherapie gelang zwar (noch) nicht. Dafür adaptierte Biontech seine Forschungsergebnisse, als ein Vakzin gegen das Coronavirus gesucht wurde. Es war der Beginn einer einzigartigen Erfolgsgeschichte – und ein Beleg für die erstklassige Arbeit deutscher Forschungseinrichtungen. Der Nebeneffekt: Deep Tech bekam durch die Coronakrise und Biontech einen gewaltigen Schub.
Quantencomputer stehen im Fokus
Wissenschaftliche Exzellenz gilt als Innovationstreiber. Vor allem beim Thema Quantencomputer wird die Arbeit an deutschen Hochschulen, in Start-ups und von Hidden Champions weltweit neidisch beäugt. Martin Hofmann, ehemaliger CIO von Volkswagen, ist darüber keineswegs verwundert. Schließlich weiß er um die jahrelange ausgezeichnete Grundlagenforschung, insbesondere in der Physik. Hofmann sagt: „Es braucht wenige, aber hoch spezialisierte Leute, die wissen, wie man mathematische Probleme in einer anderen Modellierung herunterbrechen kann. Diese Personen haben wir in Deutschland.“ Und sie könnten in naher Zukunft dafür sorgen, dass die Karten in puncto Technologieführerschaft doch noch einmal neu gemischt werden.
Fest steht: Quantencomputer sind nicht nur ein Ergebnis der Deep-Tech-Ära, sie beschleunigen den weiteren Wandel auch wesentlich. Denn sie sind in der Lage, komplexere Rechenleistungen als klassische Computer zu erbringen. Und das gelingt schon jetzt in einem Bruchteil der Zeit, obwohl die Entwicklung von Hardware und Algorithmen noch in den Kinderschuhen steckt.
Investoren stehen Schlange
Deep Tech umfasst neben Quantencomputing und BioTech auch die Bereiche Künstliche Intelligenz, Materialforschung, Nanotechnologie und Robotik. Deep Tech kann Unternehmen entscheidende Wettbewerbsvorteile verschaffen und ganze Branchen auf die nächste Stufe heben. Deep Tech kann aber auch dabei helfen, die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu erreichen – beispielsweise im Kampf gegen den Klimawandel oder bei der Bekämpfung von Armut. Immer mehr Gründerinnen und Gründer wollen diese Herausforderungen angehen und setzen auf das Thema Deep Tech – genau wie Investoren.
Laut einer aktuellen Erhebung der Förderbank KfW entfällt in Deutschland ein größer werdender Anteil am wachsenden Venturecapital-Markt auf Biotech- und Deep-Tech-Start-ups. Davon profitieren zum Beispiel das deutsche Raumfahrtunternehmen Isar Aerospace oder CarbonStack aus Hamburg, das CO2-Kompensation transparenter machen will. Beide Unternehmen sind auf dem Sprung, die Deep-Tech-Ära – das goldene Zeitalter – mitzuprägen.

Mehr Mut zur Transformation
 Margret Suckale | Aufsichtsrätin
Margret Suckale | Aufsichtsrätin
„Die Chancen durch neue Technologien überwiegen bei Weitem die Risiken. Dass wir schlecht gestartet sind – das hat mich enorm geärgert –, liegt daran, dass wir begonnen haben, das Thema Digitalisierung mit Arbeitsplatzabbau und Verlustängsten zu verbinden. Nun wundern wir uns, dass Arbeitnehmer skeptisch sind. Mitarbeiter gezielt weiterzubilden und ihnen die Vorteile der Digitalisierung zu verdeutlichen ist daher eine der wichtigsten Aufgaben.“
 Dr. Martin Sonnenschein | Aufsichtsratschef der Heidelberger Druckmaschinen AG
Dr. Martin Sonnenschein | Aufsichtsratschef der Heidelberger Druckmaschinen AG
„Die Pandemie hat schnell Veränderungen im Verhalten erzeugt. Die Ukraine-Krise ist ein weiterer Einschlag. Beides hat gezeigt, wie flexibel wir Menschen im Denken und Handeln sein können. Mehr grundsätzliche Offenheit für Veränderungen wünsche ich mir deshalb von der Zivilgesellschaft. Das Individuum bleibt der Motor unserer Zukunftsfähigkeit, denn technologischer Fortschritt führt nur gemeinsam mit Verhaltensveränderungen zu Innovation.“
 Angelika Gifford | Vice President for Europe, the Middle East and Africa bei Meta
Angelika Gifford | Vice President for Europe, the Middle East and Africa bei Meta
„Wir müssen bei der Digitalisierung noch interdisziplinärer werden. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssen Hand in Hand arbeiten. Covid-19 hat uns einen Schub gegeben. Die Situation ist besser, als viele sie darstellen. Wir haben eine Menge zu bieten. Gleichzeitig gibt es noch viel zu tun, und wir müssen ein bisschen mehr darüber reden.“
 Hagen Rickmann | Geschäftsführer des Geschäftskundenbereichs der Telekom Deutschland
Hagen Rickmann | Geschäftsführer des Geschäftskundenbereichs der Telekom Deutschland
„Ich sehe viel Potenzial im Bereich KI. Dadurch können wir Prozesse beschleunigen und automatisieren. Das wird uns auch beim Thema Nachhaltigkeit helfen. Die Frage ist: Wie weit lasse ich es kommen, und wie gehe ich damit ethisch und moralisch um? Entscheidungen müssen immer wieder hinterfragt werden.“

Ein Quantum Zuversicht
Bei der digitalen Transformation läuft Deutschland seit Jahren hinterher und belegt in verschiedenen internationalen Vergleichen nur hintere Plätze. Daran hat auch der Digitalisierungsschub durch die Coronapandemie nichts geändert. Doch Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft glauben, dass Deutschland das nächste Technologiezeitalter entscheidend mitprägen kann – das der Quantencomputer. Und die können zu echten Gamechangern für einzelne Unternehmen und ganze Branchen werden.
Martin Hofmann, ehemaliger CIO von Volkswagen und jetzt Berater bei Salesforce, sagt: „Quantencomputing ist nicht ressourcenintensiv. Es braucht nur wenige, aber dafür hoch spezialisierte Leute, die wissen, wie man mathematische Probleme in eine andere Modellierung herunterbrechen kann. Und diese Personen haben wir in Deutschland.“ Im Bereich Quantenphysik betrachtet Hofmann die Bundesrepublik deshalb – neben Großbritannien – als weltweit führend.
Wettlauf um mehr Qubits
Ein Quantencomputer macht sich die Gesetze der Quantenmechanik zu eigen. Statt der geläufigen Bits mit den Zuständen 0 und 1 nutzt er sogenannte Quantenbits (Qubits), die mehrere Zustände gleichzeitig annehmen und untereinander verschränkt sein können. Dadurch werden wesentlich komplexere Rechenleistungen möglich, die ein klassischer Computer gar nicht leisten könnte – in einem Bruchteil der Zeit.
Quantencomputer stehen zwar noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung. Trotzdem liefern sich Wissenschaftler in den Labors der Hochschulen und Universitäten, aber auch Tech-Riesen wie Google, Microsoft und IBM einen Wettlauf um mehr Qubits, neue Use-Cases und die Entwicklung passender Algorithmen.
Die Forschungsplattform „IBM Quantum System One“, die im Juni 2021 im baden-württembergischen Ehningen eingeweiht wurde, ist der erste deutsche Quantencomputer. Bald sollen weitere dazukommen. Vielleicht ja auch welche, die Alexander Glätzle mit seinem gerade gegründeten Start-up baut. Er empfiehlt Unternehmen, frühzeitig auf die neue Technologie zu setzen, um nicht wieder den Anschluss zu verlieren: „Damit wir aber gemeinsam den nächsten Schritt machen können, brauchen wir viele spannende Use-Cases, die für Unternehmen wirtschaftlich Sinn machen.“
 Welche Rolle spielen Quantencomputer in der Zukunft?
Welche Rolle spielen Quantencomputer in der Zukunft? Können Sie konkrete Beispiele dafür nennen?
Können Sie konkrete Beispiele dafür nennen? Braucht in Zukunft jedes Unternehmen einen Quantencomputer?
Braucht in Zukunft jedes Unternehmen einen Quantencomputer? Experten haben als weiteres wichtiges Anwendungsbeispiel für Quantencomputing auch die Kernfusion ins Spiel gebracht. Wäre das ein Gamechanger, um unseren Energiebedarf zukünftig zu decken?
Experten haben als weiteres wichtiges Anwendungsbeispiel für Quantencomputing auch die Kernfusion ins Spiel gebracht. Wäre das ein Gamechanger, um unseren Energiebedarf zukünftig zu decken? Glauben Sie, dass Europa beim Thema Quantencomputing eine Chance gegenüber den Amerikanern hat?
Glauben Sie, dass Europa beim Thema Quantencomputing eine Chance gegenüber den Amerikanern hat?Videocredit: Getty Images/Floaria Bicher, Getty Images/da-kuk
Bildcredits: Getty Images/Nataniil, Getty Images/pialhovik, Getty Images/Rudzhan Nagiev, PR