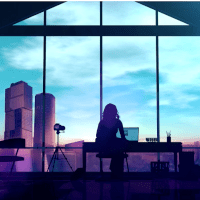27.04.2021 Thomas Eilrich
Stefan Stenzel übt regelmäßig den Spagat. Er leitet den Mittelständler VINCORION, der in klassischen Industrien Mechatronik-Lösungen maßschneidert, und ist gleichzeitig Teil des Top-Managements im Technologiekonzern Jenoptik. Ein Gespräch über Tradition und Transformation.