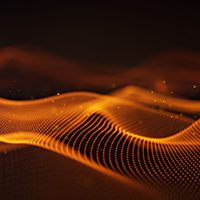Drei Viertel der Ärztinnen und Ärzte hierzulande sehen die Digitalisierung als Chance für die Medizin. Denn dadurch ließen sich die Qualität der Versorgung verbessern und die Kosten für das Gesundheitssystem senken. Das zeigt eine gemeinsame Studie des Digitalverbands Bitkom und des Ärzteverbands Hartmannbund. Zwei Drittel der Befragten geht die Transformation des Gesundheitswesens allerdings nicht schnell genug.
Der „E-Health Monitor 2022“ der Beratung McKinsey bestätigt, dass der Ausbau der vernetzten Gesundheitsversorgung vorangeht – aber nur zögerlich. Und dass, obwohl die technologische Basis vielerorts inzwischen vorhanden ist: Zum Ende des zweiten Quartals 2022 waren 96 Prozent der Hausarztpraxen und 99 Prozent der Apotheken an die Telematik-Infrastruktur (TI) angeschlossen. Sie soll die Kommunikation und den Datenaustausch zwischen allen Leistungserbringern sowie mit den Patientinnen und Patienten erleichtern.
Was bremst die Digitalisierung?
Und dennoch wird mehrheitlich auf analoge Kommunikation gesetzt. Nur zwölf Prozent der Kommunikation zwischen Arztpraxen und Krankenhäusern läuft digital ab. Zum einen beklagt die Hälfte der Arztpraxen, die an die TI angeschlossen sind, wöchentlich technische Fehler – im Vorjahr lag der Wert noch bei 36 Prozent. Zum anderen ist die digitale Reife der deutschen Krankenhäuser gering. Diese bewerteten die Kliniken selbst im „DigitalRadar Krankenhaus“ mit durchschnittlich 33 von 100 Punkten. Das am besten bewertete Krankenhaus erreichte gerade einmal 64 Punkte.
Dr. Klaus Reinhardt, Vorsitzender des Hartmannbunds, sieht noch weitere Probleme: „Die übermäßige Regulierung und Fragmentierung des Gesundheitswesens steht dem weiteren digitalen Ausbau im Weg.“ Konkret bremse laut den von Bitkom und Hartmannbund befragten Ärztinnen und Ärzten folgendes die Digitalisierung:
- die Komplexität des Gesundheitssystems (91 Prozent)
- langfristige Zertifizierungs- und Genehmigungsverfahren (80 Prozent)
- eine zu starke Regulierung des Gesundheitssektors (76 Prozent)
- mangelhafte Digitalkompetenz der Patientinnen und Patienten (58 Prozent)
- mangelhafte Digitalkompetenz der Ärzteschaft (46 Prozent)
- hoher Aufwand für IT-Sicherheit (75 Prozent)
- eine zu strenge Auslegung des Datenschutzes (69 Prozent)
Datenschutz versus Gesundheitsschutz?
71 Prozent der Ärztinnen und Ärzte in Deutschland sind der Ansicht, Gesundheitsdaten sollten stärker erschlossen und nutzbar gemacht werden, um die medizinische Versorgung zu verbessern. 61 Prozent sehen darin sogar eine ethische Verpflichtung.
„Wenn wir es in Deutschland nicht schaffen, den Datenschutz in ein ausgewogenes Verhältnis zum Gesundheitsschutz zu bringen, werden die deutschen Patienten medizinische Leistungen künftig aus Ländern beziehen, denen diese Balance besser gelingt. Datenschutz muss zuallererst dem Wohl der Patientinnen und Patienten dienen“, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. Denn: Daten seien die Grundlage einer leistungsfähigen, auf die individuelle Situation jedes Einzelnen abgestimmten medizinischen Versorgung.
„Mit dem European Health Data Space wird auf europäischer Ebene eine einheitliche Infrastruktur und rechtliche Basis für den Einsatz von Gesundheitsdaten erarbeitet, die zügig beschlossen werden muss. Auch das im Koalitionsvertrag geplante deutsche Gesundheitsdatennutzungsgesetz muss schnell kommen“, betont Rohleder.
Gute Daten retten Leben
Schließlich kann eine andere Technologie im Gesundheitswesen ihr volles Potenzial nicht ausschöpfen, wenn keine Daten zur Verfügung stehen: die Künstliche Intelligenz (KI). „Daten sind die Basis, damit KI funktionieren kann“, sagt Alexander Britz, KI-Experte von Microsoft Deutschland. „Früher hieß es immer, man braucht ganz viele Daten für die KI. Heute gilt eher: Es müssen nicht unbedingt viele, aber richtig gute Daten sein.“
Wären die passenden Daten verfügbar, könnte das zahlreiche Leben retten: „Spitzentechnologien wie Robotik, Virtual Reality und Künstliche Intelligenz werden künftig mehr Menschen denn je helfen, gesund zu werden und zu bleiben. Sie helfen Ärztinnen und Ärzten dabei, zielgenau zu diagnostizieren und individuell zu therapieren“, sagt Rohleder.
Einsatz von KI genießt wenig Vertrauen
Doch nicht jeder liebt die selbstlernende Technologie. Eine Umfrage des TÜV-Verbands zeigt, wie dicht Fortschrittsglauben und Skepsis in Deutschland beisammen liegen. So glauben zwar 66 Prozent der Befragten grundsätzlich daran, dass KI-Anwendungen positive Effekte auf die Gesundheit haben können. Allerdings sinkt das Vertrauen, sobald es um das eigene Wohl geht. Dann gehen nur noch 41 Prozent davon aus, dass eine KI beim Verdacht einer ernsten Erkrankung die richtige Diagnose stellen kann.
Und auch die Ärzteschaft verspielt ihren Vertrauensvorschuss, wenn sie auf technische Unterstützung setzt. Diagnostizieren Medizinerinnen und Mediziner alleine oder mithilfe ihrer menschlichen Kolleginnen und Kollegen, vertrauen 81 Prozent der Befragten auf ihr Urteil. Hilft eine KI bei der Diagnose, sinkt das Vertrauen auf 67 Prozent.
„Hier könnte sich die Angst vor dem Unbekannten, vor dem nicht Nachvollziehbaren zeigen“, sagt Mark Küller, Referent für Medizinprodukte beim TÜV-Verband. „Wenn ein Arzt vor mir in ein Fachbuch schaut, kann ich das im Zweifel nachlesen. Was aber die KI macht, erscheint mir als Patient immer als Black Box.“
KI darf nicht alles
Zugleich beruhigt Küller auch: In Deutschland dürfe ein KI-Medizinprodukt keine Diagnose stellen. „Die KI darf nur unterstützen, aber nicht etwa die Schlussfolgerungen zur Behandlung ziehen. Die Entscheidung liegt immer bei Ärztinnen und Ärzten.“
Dass KI im Einsatz ist, ist Patientinnen und Patienten mitunter allerdings gar nicht bewusst. Die selbstlernende Software spürt in der bildgebenden Diagnostik bereits seit Jahren auffällige Muster und Anomalien auf – und erkennt so im Frühstadium beispielsweise Krebszellen. Laut Bitkom nutzen derzeit neun Prozent der Kliniken KI etwa zur Auswertung von Röntgen- oder MRT-Bildern; weitere 54 Prozent hätten Interesse an der Technologie.
„Je mehr Klarheit darüber besteht, welchen großen Nutzen KI hier bereits stiftet und welche großen Chancen die Technologie bei der Diagnose und Behandlung von Krankheiten bietet, desto mehr wird auch das Vertrauen in die Digitaltechnik wachsen“, sagt Küller. „Gesundheit ist ein hochsensibles Thema, weshalb der Vertrauensaufbau in der Bevölkerung ein schwieriger und langer Prozess ist.“
Gesetzgebung anpassen
Neben mehr Aufklärung zum Einsatz und Nutzen von KI im Gesundheitswesen müsse aus Sicht von Küller zusätzlich bei gesetzlichen Anforderungen nachgebessert werden.
„Eine Zertifizierung lernender und sich verändernder Medizinprodukte ist im Rahmen der bestehenden rechtlichen Vorgaben zum Teil nicht möglich“, sagt der TÜV-Experte. Doch gerade das besonders Innovative an KI – ihre Lernfähigkeit über das Training mit neuen Datensätzen – könne die Nachvollziehbarkeit ihrer Entscheidungen erschweren und im Zweifel komplizierte Haftungsfragen aufwerfen.
Insbesondere in Bezug auf gesundheitsbezogene Apps sieht Küller eine Grauzone: „Sehr viele Apps, die als Gesundheits-, Wellness- oder Lifestyle-Apps vermarktet werden, sind aufgrund ihrer Beschaffenheit und ihres Nutzenversprechens eigentlich Medizinprodukte.“ Eine Zulassung nach der EU-Medizinprodukteverordnung haben allerdings die wenigsten Apps. Und das birgt Risiken, so der Branchenexperte: „Sofern der Hersteller verspricht oder erklärt, dass sein Produkt zum Beispiel einen medizinischen Indikator genau misst, das Produkt dies tatsächlich aber nicht leistet, können Fehlentscheidungen durch Anwender getroffen werden und gesundheitliche Risiken entstehen.“